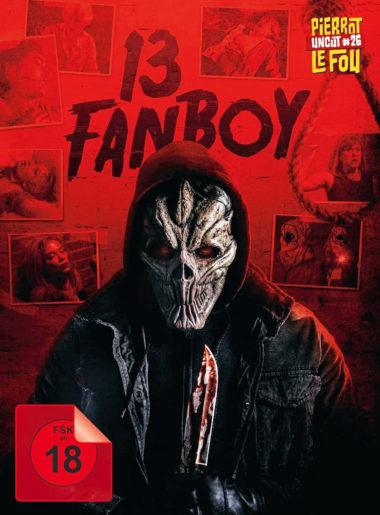Was lange währt… mehrfach wurde ihre Veröffentlichung verschoben, doch nun steht die „Federico Fellini Edition“ im Regal. Das Boxset beinhaltet neun (Blu-ray-Version) beziehungsweise zehn (DVD-Version) Filme des italienischen Meisterregisseurs, die teilweise zum ersten Mal in Remastered-Form auf dem deutschen Markt erhältlich werden. Auch wenn einige Meisterwerke vermisst werden, ist der Startpreis für das Gebotene angemessen, hat man es doch mit mindestens durchweg sehenswerten Filmen aus drei Jahrzehnten zu tun. Einzig mit Fellinis Eigenarten muss sich der Zuschauende einen Umgang erarbeiten, denn einfach macht er es einem mit seinen äußerst persönlichen Werken nun wirklich nicht.
Was lange währt… mehrfach wurde ihre Veröffentlichung verschoben, doch nun steht die „Federico Fellini Edition“ im Regal. Das Boxset beinhaltet neun (Blu-ray-Version) beziehungsweise zehn (DVD-Version) Filme des italienischen Meisterregisseurs, die teilweise zum ersten Mal in Remastered-Form auf dem deutschen Markt erhältlich werden. Auch wenn einige Meisterwerke vermisst werden, ist der Startpreis für das Gebotene angemessen, hat man es doch mit mindestens durchweg sehenswerten Filmen aus drei Jahrzehnten zu tun. Einzig mit Fellinis Eigenarten muss sich der Zuschauende einen Umgang erarbeiten, denn einfach macht er es einem mit seinen äußerst persönlichen Werken nun wirklich nicht.
Fellinis Lebensweg ist eng mit der jungen italienischen Geschichte verbunden. Federico Fellini aus Rimini erlebte das Aufkommen und das Ende des Faschismus in seiner Jugendzeit hautnah mit und wurde in dörflichen Verhältnissen nach dem Dafürhalten der damaligen Zeit katholisch erzogen. Damit, so könnte man verkürzt meinen, wäre mit Blick auf seine Filmographie schon alles erklärt. Nachdem sich Fellini zuhause und in Rom mal hiermit, mal damit durchgeschlagen hat, zieht es ihn immer mehr zum Film. Er profiliert sich als Drehbuchautor unter anderem für Roberto Rossellini und fügt schließlich 1950 mit „Lichter des Variéte“ als Co-Regisseur der Filmgeschichte sein erstes eigenes Werk hinzu.
 Auch wenn der Film und ebenso das zwei Jahre später folgende „Lo sceicco bianco“ wenig nachhaltigen Eindruck hinterließen, so sind die typischen Fellini-Themen hier schon angelegt. Das zeigt „Die Müßiggänger“ aus dem Jahr 1953, mit dem Fellini sein erster Hit gelinge sollte. In der Geschichte der Clique um Moraldo (Franco Interlenghi) und Fausto (Franco Fabrizi) verarbeitete der Filmemacher seine eigene Jugend in einer Satire, die mal augenzwinkernd, mal tragikomisch die vom Zwang zum Nichtstun geprägte italienische Provinz (durchaus liebevoll gemeint) aufs Korn nimmt. Der Faschismus hat vor allem die ländlichen Regionen ausbluten lassen und wenn denn hier noch jemand nach etwas strebt, dann nach Rom.
Auch wenn der Film und ebenso das zwei Jahre später folgende „Lo sceicco bianco“ wenig nachhaltigen Eindruck hinterließen, so sind die typischen Fellini-Themen hier schon angelegt. Das zeigt „Die Müßiggänger“ aus dem Jahr 1953, mit dem Fellini sein erster Hit gelinge sollte. In der Geschichte der Clique um Moraldo (Franco Interlenghi) und Fausto (Franco Fabrizi) verarbeitete der Filmemacher seine eigene Jugend in einer Satire, die mal augenzwinkernd, mal tragikomisch die vom Zwang zum Nichtstun geprägte italienische Provinz (durchaus liebevoll gemeint) aufs Korn nimmt. Der Faschismus hat vor allem die ländlichen Regionen ausbluten lassen und wenn denn hier noch jemand nach etwas strebt, dann nach Rom.
„Die Müßiggänger“ gehört zur filmischen Bewegung gegen die Verwirrungen des faschistischen Regimes und seiner Wurzeln. Statt Propaganda- und/oder pompöse Historien-Filme zu schaffen, wird im Neorealismus der Alltag der Menschen inszeniert, auch um das Kino zu entmystifizieren. Es sollte nicht um die abstrakten Lehren der großen Geschichten und Herrschern, sondern um die menschlichen Belange der Bürgerschaft gehen, deren Repräsentanz auf der Leinwand auf deren Ermächtigung oder zumindest Ermündigung abzielte. Wie in „Die Müßiggänger“ zu sehen ist, war dies auch nicht verklärend gemeint, vielmehr ging es um die schonungslose Auseinandersetzung mit sich selbst durch die Hauptfiguren, denen man zum ersten Mal in der Kinogeschichte ähnelte. Im Falle von Fellini heißt das in seinem ersten großen Film: Junge Erwachsene haben keine Arbeit und werden von ihren (zum Teil autoritär erziehenden) Eltern dermaßen geprägt, dass sie zu kindischen Tagträumern verkommen, die sich in der Schönheit der Frauen zu versenken versuchen.
Realismus heißt in diesem Fall aber nicht sprödes, klinisches Kino, sondern durchaus auch ein Sinn für opulente Musik und magische Momente. Wenn die Strolche sich zu einer Party zusammenfinden, dann ist das nah am Zirkus und einer Freakshow, demgegenüber Fellini eine ambivalente Beziehung pflegte. Angezogen von der Ästhetik folgt in seinen Filmen auch immer die anschließende Depression nach den Feierlichkeiten, die das hohle Moment der Realitätsflucht bravourös in Szene setzen. Eine Flucht vor der deprimierenden Provinz, die im grauen Winter noch nicht mal etwas von Urlaub hat. Verantwortung wollen sie ebenso von sich fernhalten wie jeden Anflug von Melancholie, doch die Ziel- und Perspektivlosigkeit ist unerbittlich, was damals, wie leider auch heute noch immer gilt, denn so sehr sie es sich auch wünschen, vor Schuld und Lügen sind auch sie nicht gefeit.
 Schon ein Jahr später und nach dem Episodenfilm „Love in the City“ schuf Fellini sein erstes Meisterwerk. „La Strada“ wurde seiner Zeit „Unvergleichlichkeit“ attestiert und tatsächlich muss sich der Zuschauende auch heute noch an die Machart des Films gewöhnen. Die putzige Gelsomina (Fellins Frau Giulietta Masina) wird von ihrer Mutter an den großen Zampanò (Anthony Quinn) verkauft und geht mit ihm fortan als Assistentin auf seinem umgebauten Motorrad auf Tour. Zampanò ist ein Darsteller, der mit seinen Muskeln protzt und drum herum ein wenig Show baut, um von Dorf zu Dorf sein Auskommen zu finanzieren. Das ist mitunter lustig anzusehen, weil das alles etwas von Zirkus hat. Die einfach gestrickte Gelsomina wird jedoch mit der harten Welt und den Ansichten ihres neuen Chefs konfrontiert und sehnt sich schon bald nach ihrem Zuhause. Die beiden bleiben jedoch zusammen, erleben keine großen Abenteuer, doch die kleine Frau wirkt wie das gute Gewissen des großen Mannes.
Schon ein Jahr später und nach dem Episodenfilm „Love in the City“ schuf Fellini sein erstes Meisterwerk. „La Strada“ wurde seiner Zeit „Unvergleichlichkeit“ attestiert und tatsächlich muss sich der Zuschauende auch heute noch an die Machart des Films gewöhnen. Die putzige Gelsomina (Fellins Frau Giulietta Masina) wird von ihrer Mutter an den großen Zampanò (Anthony Quinn) verkauft und geht mit ihm fortan als Assistentin auf seinem umgebauten Motorrad auf Tour. Zampanò ist ein Darsteller, der mit seinen Muskeln protzt und drum herum ein wenig Show baut, um von Dorf zu Dorf sein Auskommen zu finanzieren. Das ist mitunter lustig anzusehen, weil das alles etwas von Zirkus hat. Die einfach gestrickte Gelsomina wird jedoch mit der harten Welt und den Ansichten ihres neuen Chefs konfrontiert und sehnt sich schon bald nach ihrem Zuhause. Die beiden bleiben jedoch zusammen, erleben keine großen Abenteuer, doch die kleine Frau wirkt wie das gute Gewissen des großen Mannes.
Fellini zeigt hier vertieft die italienische Provinz, die fernab vom Urlaubsbild des Landesinneren als trostlos und unfruchtbar konstruiert wird. Alles ist von einer tiefen Schwermut umwölkt, die kaum Lichtblicke zulässt, weil den gezeigten Menschen keine Hoffnung vergönnt ist. Das heißt aber nicht, dass sie ihr Menschsein aufgeben sollten, schließlich ist es das, was sie am Leben erhält. Doch diese spirituelle Weisheit realisiert Zampanò erst, als es zu spät ist. Die Tragikomödie sollte Fellinis Metier bleiben, doch einen Anteil an roher Ernst- und Wahrhaftigkeit, aber auch Gefühl wie in „La Strada“ sollte er danach kaum mehr erreichen. Dass sich ausgerechnet die Katholische Kirche an der mythologisch-märchenhaft gemeinten, aber als biblisch interpretierten Heiligen-Geschichte erfreute, hätte Fellini nicht härter treffen können, zumal es bei der Auszeichnung mit dem Silbernen Löwen in Venedig zu einem handfesten Streit um die Ausrichtung des italienischen Films kam.
Dieses Missverständnis wollte Fellini nicht auf sich sitzen lassen und inszenierte wiederum ein Jahr später „Die Schwindler“, in der die Kleinkriminellen vornehmlich als Geistliche verkleidet die Ärmsten schröpfen, nur um das Geld für einen hohlen gehobenen Lebensstil zu verprassen. Das Haben bestimmt auch hier das Sein, nur beginnt Fellini nun das Streben nach Reichtum als lächerlich darzustellen, da es keinen Wert an sich hat. Im Grunde denkt er hier die Armut der ländlichen Bevölkerung weiter und fragt sich, wo das Geld landet und für welche Zweckerfüllung es eingesetzt wird. Das erweitert zwar den Horizont, da Fellini nun eine größere Bandbreite an Musik und Varieté-Nummern einarbeiten kann, gleichzeitig nimmt die Tragikomödie zunehmend zynische Züge an.
Auch hier sind Nichtsnutze am Werk, die angeführt vom gealterten Augusto (Broderick Crawford) nicht weniger Kinder geblieben sind als die Jungs auf dem Land. So richtig mag sich Fellini nicht entscheiden, welches Alter er nun vorzieht, es ist wohl eher das verkrampfte Zusammenspiel aus alter Schule und jugendlichen Aufbegehren, in dem er die Probleme des modernen Italiens erkennen will. Die Party-Szenen sind laut und überfordernd, weil sie in ihrer Ziellosigkeit gerne mal aus dem Ruder laufen. Alle sind in einem Teufelskreis gefangen, der sie von jedwedem Skrupel befreien und so ist es folgerichtig, dass auch die versuchte Versöhnung mit der eigenen Familie in der Tragödie enden muss.
 Nach diesem bitteren und wenig erfolgreichen Film – so ist es aus der Retrospektive wohl zu deuten – versuchte sich Fellini an einem Kompromiss aus seinen beiden vorangegangenen Filmen. Nur die DVD-Version der Box beinhaltet „Die Nächte der Cabiria“, der zwar qualitativ aufgebessert und um die ursprünglich sieben zensierten Minuten erweitert wurde, auf eine Blu-ray-fähige Fassung aber wohl nicht mehr aufzuhübschen war. Dieses Mal spielt Giulietta Masina die Prostituierte Cabiria, die ihren Stolz aus dem Haus bezieht, das sie sich von ihren Einkünften kaufen konnte. Doch ihr Leben wäre fast vorbei gewesen, als sie von einem Freier bei einem heimtückischen Überfall in einen Fluss geschubst wird. Die gutgläubige Cabiria, die sich nach Liebe sehnt, wird daraufhin von ihren Kolleginnen verhöhnt, die sich schon längst mit der Brutalität der Welt abgefunden haben und sich teilweise den Drogen hingeben.
Nach diesem bitteren und wenig erfolgreichen Film – so ist es aus der Retrospektive wohl zu deuten – versuchte sich Fellini an einem Kompromiss aus seinen beiden vorangegangenen Filmen. Nur die DVD-Version der Box beinhaltet „Die Nächte der Cabiria“, der zwar qualitativ aufgebessert und um die ursprünglich sieben zensierten Minuten erweitert wurde, auf eine Blu-ray-fähige Fassung aber wohl nicht mehr aufzuhübschen war. Dieses Mal spielt Giulietta Masina die Prostituierte Cabiria, die ihren Stolz aus dem Haus bezieht, das sie sich von ihren Einkünften kaufen konnte. Doch ihr Leben wäre fast vorbei gewesen, als sie von einem Freier bei einem heimtückischen Überfall in einen Fluss geschubst wird. Die gutgläubige Cabiria, die sich nach Liebe sehnt, wird daraufhin von ihren Kolleginnen verhöhnt, die sich schon längst mit der Brutalität der Welt abgefunden haben und sich teilweise den Drogen hingeben.
Fellini zeigt die harsche Realität einer Branche, für die die Filmwelt 1957 noch keinen Platz im Kino sah. Prostituierte in allen Formen und Arten fangen gerade durch „Die Nächste der Cabiria“ einen Weg auf die Leinwand, wo sie zwar keineswegs zu Heiligen erhoben werden, jedoch zu einer Empathie-Übung aufruft, um zumindest eine Annäherung zu schaffen. Der Film schafft es zudem zu zeigen, dass die hinter der mit Sexualität in Verbindung gebrachten Lebenslust häufig eine tiefe Traurigkeit steckt. Abermals arbeitet sich Fellini an Shows, der Religion und der Gesellschaft ab, bis schließlich ein Mann daherkommt, der sich in Cabiria verliebt. Doch gerade als es so scheint, dass die kleine Frau ihr altes Leben hinter sich lassen könnte, wird abermals auf tragische Weise klar, dass Geld den Menschen auf ganz eigentümliche Weise korrumpiert.
Ja und dann erreicht Fellini neue Höhen und gibt sich dem süßen Leben hin. „La Dolce Vita“ ist der vielleicht bekannteste Titel aus dem Schaffen des Italieners und gleichsam der längste seiner Filme. Ab jetzt beschäftigen sich Fellinis Filme vornehmlich mit den „oberen 10.000“ und ihren bedeutungsvollen Symbolen als Ersatz für ein bedeutungsloses Leben. Der Paparazzo Marcello (Marcello Mastroianni) hat einen Kompromiss geschlossen: Statt seinem Traum nachzugehen, Schriftsteller zu werden, schreibt er für die Klatschpresse, um sich ein Leben in Rom finanzieren zu können. Dabei ist er so nah dran an den Sternchen, dass sie es auch Beziehungen sein könnten. Allerdings – und auch hier nimmt Fellini Heutiges vorweg – spielt sich das Leben der Reichen und Schönen nur noch in der Öffentlichkeit ab.
 Paparazzi greifen ein, verändern Szenen und führen Regie, sodass vom wahren Leben gar nichts mehr übrigbleiben kann. Stars genießen zwar Aufmerksamkeit, doch was ist sie wert, wenn sie nur in einer Plastikwelt leben? Dazu noch in Rom, wo alles laut dröhnt und hell blendet? Wo das Innere den Kontakt zur Außenwelt völlig verloren hat, die aber gleichsam in den Vororten einer stetig wachsenden Stadt immer näherkommt? Was soll der ganze Schein, wo ist das Sein? Logisch, dass in den besseren Kreisen alles in wahnsinnigem Gelächter ausbricht ob der eigenen Leere. Religion spielt für sie (auch aufgrund ihrer Sünden) keine Rolle mehr, doch ein Ersatz in Spiritualität ist mehr als willkommen, denn auch in Sachen Liebe sind die Menschen verkrüppelt und tun sich aberwitzige Dinge an. Heuchlerei, Naivität, Ekel, all das verbirgt sich hinter dem süßen Leben, das schließlich im Zusammenbruch, in der Anomie endet, da nichts mehr da ist, was das Leben ausmacht: keine Kommunikation, keine Natur, keine Familie, keine Liebe, nur noch schiere Angst. Kondensiert in herumtollenden Figuren in einem viel zu schönen Brunnen.
Paparazzi greifen ein, verändern Szenen und führen Regie, sodass vom wahren Leben gar nichts mehr übrigbleiben kann. Stars genießen zwar Aufmerksamkeit, doch was ist sie wert, wenn sie nur in einer Plastikwelt leben? Dazu noch in Rom, wo alles laut dröhnt und hell blendet? Wo das Innere den Kontakt zur Außenwelt völlig verloren hat, die aber gleichsam in den Vororten einer stetig wachsenden Stadt immer näherkommt? Was soll der ganze Schein, wo ist das Sein? Logisch, dass in den besseren Kreisen alles in wahnsinnigem Gelächter ausbricht ob der eigenen Leere. Religion spielt für sie (auch aufgrund ihrer Sünden) keine Rolle mehr, doch ein Ersatz in Spiritualität ist mehr als willkommen, denn auch in Sachen Liebe sind die Menschen verkrüppelt und tun sich aberwitzige Dinge an. Heuchlerei, Naivität, Ekel, all das verbirgt sich hinter dem süßen Leben, das schließlich im Zusammenbruch, in der Anomie endet, da nichts mehr da ist, was das Leben ausmacht: keine Kommunikation, keine Natur, keine Familie, keine Liebe, nur noch schiere Angst. Kondensiert in herumtollenden Figuren in einem viel zu schönen Brunnen.
Fellini hatte ein Level erreicht, von dem er sich nicht mehr zurückzog, das ihm aber zunehmend zusetzte. Mit „8 ½“ verarbeitete er seine Schreibblockade, indem er sie einfach autobiographisch zum Thema machte und endgültig seine neorealistischen Wurzeln kappte. Auch der Filmemacher Guido Anselmi (Marcello Mastroianni) steckt in einer Schaffenskrise und findet sich zunehmend in einer Welt wieder, in der sich Realität und Surrealität nicht voneinander unterscheiden lassen. Mit diesem Metafilm entledigte sich Fellini den Fesseln der Kritik und des eigenen Anspruchs und findet darin eine befreiende Moral, die in ihrer positiven Message überrascht. Sicher, Bilder konnte Fellini schon immer, doch solch fantastische Aufnahmen waren in Verbindung mit seinem Namen eine neue Erfahrung und machten „8 ½“ – neben zahlreichen anderen Momenten – zum besten Werk seiner Karriere.
![]() Spätestens nach dem ähnlich gelagerten „Juliet of the Spirits“, das die Box überspringt, ist Fellini wie ausgewechselt. Nicht unbedingt in thematischer, aber vor allem in formeller Hinsicht wirkt er befreit – aber irgendwie auch verkopft. Nachdem der Neorealismus Anfang der 1960er-Jahre sein Ende fand, unterschrieb Fellini für einen Stoff, der dem gescholtenen „Sandalenfilm“ erstaunlich nah kam. Eine Reihe an mystischen Sagen drückt der Filmemacher jedoch seinen Namen auf und so entstand „Fellinis Satyricon“, sein erster Farb-Film und ein extremes Experiment. Riesige Kulissen, theaterhafte Darstellungen und ein widerwilliges Interesse am Überfluss der Mächtigen würden von nun an die meisten von Fellinis Werken durchziehen. Fellini spielt in dieser Satire mit den Extremen, beleuchtet explizit Sex, Gier, eigentlich das Verfaulen der Menschheit in der Sündigkeit.
Spätestens nach dem ähnlich gelagerten „Juliet of the Spirits“, das die Box überspringt, ist Fellini wie ausgewechselt. Nicht unbedingt in thematischer, aber vor allem in formeller Hinsicht wirkt er befreit – aber irgendwie auch verkopft. Nachdem der Neorealismus Anfang der 1960er-Jahre sein Ende fand, unterschrieb Fellini für einen Stoff, der dem gescholtenen „Sandalenfilm“ erstaunlich nah kam. Eine Reihe an mystischen Sagen drückt der Filmemacher jedoch seinen Namen auf und so entstand „Fellinis Satyricon“, sein erster Farb-Film und ein extremes Experiment. Riesige Kulissen, theaterhafte Darstellungen und ein widerwilliges Interesse am Überfluss der Mächtigen würden von nun an die meisten von Fellinis Werken durchziehen. Fellini spielt in dieser Satire mit den Extremen, beleuchtet explizit Sex, Gier, eigentlich das Verfaulen der Menschheit in der Sündigkeit.
Die historischen politischen Begebenheiten sind bloße Randerscheinung, weil die Menschen mit sich und ihrer Triebbefriedigung bis zur Trägheit im Überfluss beschäftigt sind. Perkussive, exotische Musik und monumentale Settings vermitteln eine bedrohliche Welt, ja eine Hölle auf Erden, die jedoch nicht aus der Abwesenheit Gottes entstanden ist, sondern aus seiner Perversion durch den Menschen. Barbareien, Beleidigungen und Perversitäten sind die Folge von Extravaganzen der Macht, die sich in Orgien und Rauschzuständen abschießen und dem Diesseits nicht ferner sein könnten. Satyricon hinterlässt fraglos einen Eindruck und fasziniert, doch der Film überfordert auch in seinem Anspruch auf Totalität. Diese wird Fellini fortan immer für sich beanspruchen, doch ob er damit alles rechtfertigen kann, darf bezweifelt werden.
 In „Roma“ gelingt Fellini 1972 zumindest ein interessantes Porträt der Hauptstadt, die ihren Titel wie kaum eine andere verdient. Alles läuft hier zusammen, Administration, Kultur, Macht, alles schaut nach Rom. Schon immer, von den Römern über den Faschismus bis in die Gegenwart. Fellini zeigt in seinen wieder mal lauten und bunten Vignetten die Genese des italienischen Volkes und rechnet abermals mit dem Faschismus ab. Dieser habe den Stolz des Römischen Reiches für sich genutzt, um die Bevölkerung zu emotionalisieren und deswegen funktioniert die mondäne und Macht ausstrahlende Schönheit der Hauptstadt. Doch alle wollen nach Rom und wollen sie zu ihren eigenen Zwecken uminterpretieren, die Reichen, die Filmemacher, die Hippies, doch nach dem Kern, was eine Stadt ausmacht, danach sucht keiner.
In „Roma“ gelingt Fellini 1972 zumindest ein interessantes Porträt der Hauptstadt, die ihren Titel wie kaum eine andere verdient. Alles läuft hier zusammen, Administration, Kultur, Macht, alles schaut nach Rom. Schon immer, von den Römern über den Faschismus bis in die Gegenwart. Fellini zeigt in seinen wieder mal lauten und bunten Vignetten die Genese des italienischen Volkes und rechnet abermals mit dem Faschismus ab. Dieser habe den Stolz des Römischen Reiches für sich genutzt, um die Bevölkerung zu emotionalisieren und deswegen funktioniert die mondäne und Macht ausstrahlende Schönheit der Hauptstadt. Doch alle wollen nach Rom und wollen sie zu ihren eigenen Zwecken uminterpretieren, die Reichen, die Filmemacher, die Hippies, doch nach dem Kern, was eine Stadt ausmacht, danach sucht keiner.
Selbst die Öffentlichkeit ist familiär, die Straßen sind zum Wohnzimmer geworden und insoweit haben die Römer das „Recht auf Stadt“ missverstanden. Wieder gibt es einen Film im Film, der das Private nicht privat lassen will, aber zumindest mit dem Auge der Kunst das beste im Sinn hat. Aber wieder hat es etwas von einer Hölle, wenn der Kamerawagen auf der Autobahn ins gegenwärtige Rom fährt, der Weg gesäumt von brennenden Autoreifen, Pennern, Nutten und anderen Außenseitern. Es ist die Hauptstadt eines Landes, das aufgerieben ist zwischen Religion und Faschismus, das ein Proletariat hervorgebracht hat, das den Sittenverfall bis zur Missachtung der Kunst treibt.
In „Amarcord“ gelingt das serielle Erzählung noch einmal sehr gut, bevor sich Fellini im Pomp verfängt, den er zu kritisieren versucht. Auch die Geschichte des Casanova macht der Regisseur sich zu eigen, auch weil er einen Vertrag unterschrieben hat, bevor sich mit dem mittelalterlichen Frauenhelden näher beschäftigte. Nach der Lektüre ist er angewidert von der Leere dieses Menschen und seines Lebens und beschließt, einen ebenso gelagerten Film zu drehen. Das zutiefst zynische, epische Werk von fast zweieinhalb Stunden Länge ist ein zäher Brocken, an dessen Bilder man sich noch am ehesten erfreuen kann. Hier liegt aber der Verdacht nahe, dass sich Fellini eben auch an diesen festhielt und nicht umsonst drei ganze Jahre ausschließlich in einem Studio an dem epochalen Werk herumdoktorte.
 Es kann also nicht alles auf den Zwang einer Auftragsarbeit geschoben werden, wenn „Fellinis Casanova“ zur Bewertung steht. Sex ist hier das große Thema, die Potenz des Mannes und eines besonderen Herren, der von sich behauptete, er könne acht Mal hintereinander Liebe machen. Fellini zieht dies ins Lächerliche, inszeniert die Sexszenen möglichst peinlich und comichaft und macht aus dem von Donald Sutherland gespielten und weltweit bewunderten Casanova eine Witzfigur. Der Frauenheld lebte ein völlig nach außen gekehrtes Leben, gab Fellini einmal zu Protokoll, er war frei von jedweder Privatheit. Casanova passt perfekt zu Fellinis Werk, bloß weiß der Filmemacher nicht, was er noch aus diesem langweiligen Menschen ziehen soll. Und so kommt ein langweiliger Film heraus, der sich aber nicht darüber retten kann, dass er auch genauso sein wollte.
Es kann also nicht alles auf den Zwang einer Auftragsarbeit geschoben werden, wenn „Fellinis Casanova“ zur Bewertung steht. Sex ist hier das große Thema, die Potenz des Mannes und eines besonderen Herren, der von sich behauptete, er könne acht Mal hintereinander Liebe machen. Fellini zieht dies ins Lächerliche, inszeniert die Sexszenen möglichst peinlich und comichaft und macht aus dem von Donald Sutherland gespielten und weltweit bewunderten Casanova eine Witzfigur. Der Frauenheld lebte ein völlig nach außen gekehrtes Leben, gab Fellini einmal zu Protokoll, er war frei von jedweder Privatheit. Casanova passt perfekt zu Fellinis Werk, bloß weiß der Filmemacher nicht, was er noch aus diesem langweiligen Menschen ziehen soll. Und so kommt ein langweiliger Film heraus, der sich aber nicht darüber retten kann, dass er auch genauso sein wollte.
Ähnliches gilt für „Stadt der Frauen“, die direkte Verhandlung des Frauenhelds mit dem Feminismus. Marcello (Marcello Mastroianni) begegnet auf einer Zugfahrt einer hübschen Dame, der er aus dem Zug folgt, bis dieser ihn irgendwo im Nirgendwo zurücklässt. Die Frau lässt ihn gerade so weit ran, dass er sie bis zu einem Hotel verfolgt, in dem der Casanova seinen Augen nicht trauen kann: Praktisch nur junge Frauen sieht er dort, eine schöner als die andere. Doch schnell wendet sich das Blatt, denn Marcello ist auf einem Feministinnenkongress gelandet und wird alsbald als Verräter beschuldigt, verfolgt, verurteilt und eingekerkert wird. Es folgt eine Reise in die eigene Psyche, die sich oftmals allzu sehr am Abhaken von Argumenten orientiert als auch infantilen Klamauk und Peinlichkeiten bedient – oder warum müssen die Kerzen auf dem Geburtstagskuchen ausgepinkelt werden? Marcello würde kindlich naiv sagen: „Smick Smack!“. Zumindest aber das Achterbahn-Finale kann etwas entschädigen, bevor Marcello aufwacht und die Frauen im Zugabteil über ihn kichern. Ein frühreifer #metoo-Film, dem ein wenig Subtilität und ein konsequenterer Schnitt aber sicher gut getan hätte.
 Nach diesem 1980 erschienen Film folgten noch vier weitere, bevor Fellini 1993 im Alter von 73 Jahren verstarb. Eine spannende Karriere war ihm vergönnt, wie die neun beziehungsweise zehn Filme der Boxsets beweisen. Manche ebendieser sind nun zum ersten Mal auf Blu-ray erschienen, aufgrund der Verschiebung der Veröffentlichung ausnahmsweise auch schon einzeln zeitlich vor dem Set. Einzig ein wenig mehr Bonus Material hätte nicht schaden können, so gibt es nur Interviews zu „La Strada“ und geschnittene Szenen aus „Casanova“. Aber vielleicht entschädigt das 80-seitige Booklet, das dem Rezensenten nicht zur Besprechung vorlag. Wer Fellini in bester Qualität frönen möchte, bekommt hier bei Startpreisen von 59,99€ (DVD) und 74,99€ ein attraktives Angebot, doch Vorsicht: Purer Filmgenuss sind Fellini-Filme nicht immer.
Nach diesem 1980 erschienen Film folgten noch vier weitere, bevor Fellini 1993 im Alter von 73 Jahren verstarb. Eine spannende Karriere war ihm vergönnt, wie die neun beziehungsweise zehn Filme der Boxsets beweisen. Manche ebendieser sind nun zum ersten Mal auf Blu-ray erschienen, aufgrund der Verschiebung der Veröffentlichung ausnahmsweise auch schon einzeln zeitlich vor dem Set. Einzig ein wenig mehr Bonus Material hätte nicht schaden können, so gibt es nur Interviews zu „La Strada“ und geschnittene Szenen aus „Casanova“. Aber vielleicht entschädigt das 80-seitige Booklet, das dem Rezensenten nicht zur Besprechung vorlag. Wer Fellini in bester Qualität frönen möchte, bekommt hier bei Startpreisen von 59,99€ (DVD) und 74,99€ ein attraktives Angebot, doch Vorsicht: Purer Filmgenuss sind Fellini-Filme nicht immer.
Fazit: Neun- und zehnmal Fellini, zum Teil zum ersten Mal auf Blu-ray, für einen angemessenen Preis, das lädt zum Kauf ein. Einer der größten Filmemacher hat ein erstaunliches Erbe hinterlassen, das weniger in den Themen als in der jeweiligen Machart stark variiert. Vom Neorealismus zum Surrealismus und zum Historienfilm bietet Fellini durchweg Sehenswertes, einen guten Schnitt an Meisterwerken, aber eben auch streitbare Brocken, die sich Kompromisslosigkeit auf die Fahnen schreiben und nicht immer gelungen sind. Fellinis Werk ist fordernd und verlangt auch mal nach eigener Recherche, wozu etwas mehr Bonus Material hilfreich gewesen wäre. Doch wer sich in der Filmwelt zurechtfinden will, kommt an Fellini nicht vorbei und kann die herausragenden Bildkompositionen nun in der besten Qualität bewundern.
Cover und Szenebilder © Arthaus
- Titel: Federico Fellini Edition
- Produktionsland und -jahr: ITA/FRA, 1953-1980
- Genre:
Drama
Comedy
Dramedy
Historienfilm
- Erschienen: 14.02.2019
- Label: Arthaus
- Spielzeit:
ca. 1245 Minuten auf 10 DVDs
ca. 1186 Minuten auf 9 Blu-Rays - Darsteller:
Diverse
- Regie: Federico Fellini
- Drehbuch:
Diverse - Kamera:
Diverse - Schnitt:
Diverse - Musik:
Diverse
- Extras:
80-seitiges Booklet; Geschnittene Szenen von “Roma”; Trailer - Technische Details (DVD)
Video: unterschiedlich
Sprachen/Ton: D, ITA, FRA
Untertitel: D, ITA, FRA
- Technische Details (Blu-Ray)
Video: unterschiedlich
Sprachen/Ton: D, ITA, FRA
Untertitel: D, ITA, FRA - FSK: 16
- Sonstige Informationen:
Produktseite