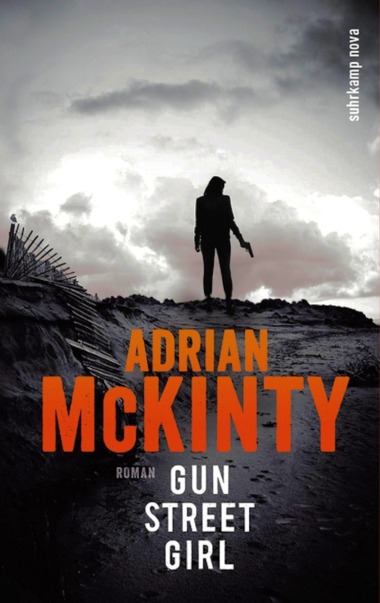Manchmal liest man 650 Seiten in zwei Tagen, ein anderes Mal braucht man für 230 Seiten eine Woche. Das kann nun daran liegen, dass schlicht die Lesezeit fehlt oder man, obwohl es sich um ein gutes Buch handelt, einfach nicht richtig in die Geschichte hineinfindet. Die dritte und im Falle von „Fünf Millionen Lösegeld“ leider zutreffende Möglichkeit ist, dass dem Buch genau die Eigenschaften fehlen, die zum Weiterlesen animieren.
Manchmal liest man 650 Seiten in zwei Tagen, ein anderes Mal braucht man für 230 Seiten eine Woche. Das kann nun daran liegen, dass schlicht die Lesezeit fehlt oder man, obwohl es sich um ein gutes Buch handelt, einfach nicht richtig in die Geschichte hineinfindet. Die dritte und im Falle von „Fünf Millionen Lösegeld“ leider zutreffende Möglichkeit ist, dass dem Buch genau die Eigenschaften fehlen, die zum Weiterlesen animieren.
Die Geschichte des Köln-Krimis ist schnell erzählt:
Vier maskierte Frauen stürmen in ein Restaurant und entführen den Sohn des gefürchteten Kölner Paten. Nachdem sie den Mann in ihr Versteck gebracht haben, fordern sie – man ahnt es schon – fünf Millionen Euro Lösegeld vom vermögenden Vater. Die Geldübergabe läuft zunächst schief, weil die Konkurrenz aus der Unterwelt ihre Chance sieht, dem Paten das Licht auszupusten. Aber auch das misslingt, und so kommt es zur zweiten, dieses Mal erfolgreichen Übergabe. Fortan begeben sich gleich mehrere Parteien auf die Jagd nach Sohnemann, den Entführerinnen und dem Lösegeld.
Was an sich nach einer guten Grundidee klingt – weibliche Entführer legen sich mit der Kölner Unterwelt an – kann die Erwartungen nicht erfüllen. Obwohl das Buch nur knapp 230 Seiten lang ist, zieht sich die Geschichte und wird auch durch die extrem kurzen Kapitel (im Schnitt etwa zwei Seiten, zum Teil sogar nur eine halbe) nicht rasanter. Im Gegenteil: Die Kapitellänge verleiht dem Krimi etwas Abgehacktes – bevor der Leser sich überhaupt in eine Situation einfinden kann, ist sie auch schon wieder vorbei. Spannung entsteht auf diese Weise nicht, ebenso wenig ermöglicht dieser „Stil“ eine Identifikation mit den Charakteren.
Die Charakterzeichnung ist ohnehin ein Thema für sich – sie existiert nämlich nicht. Die Figuren bleiben allesamt blass, ohne Tiefe und lassen jegliche Weiterentwicklung vermissen. Hier und da wird ein kurzer Schwang aus dem Leben einzelner Protagonisten erzählt, näher bringt dies dem Leser die Charaktere aber dennoch nicht. Sie sind so eindimensional gestaltet, dass man ihnen mit völliger Gleichgültigkeit gegenübersteht. Die einzigen Emotionen, die aufgrund des Verhaltens einiger Figuren hervorgerufen werden, sind hin und wieder ein entnervtes Seufzen und Augenrollen. Zu Beginn hegt man noch ein wenig die Hoffnung, dass Rebecca, die Freundin des Entführungsopfers, eine entscheidende Position einnimmt. Schließlich leidet sie am Tourette-Syndrom und sicherlich wird es doch einen Grund geben, sie ausgerechnet mit dieser Krankheit auszustatten. Weit gefehlt: Offenbar wurde die Erkrankung einzig und allein gewählt, um möglichst oft und ohne Sinn Schimpfwörter unterzubringen. Rebecca taucht zwar im Verlauf noch einmal auf, ihre Ticks spielen aber keine tiefere Rolle.
Inhaltlich fallen insbesondere die Aneinanderreihung von Klischees (ein Toter wird in einen Teppich eingewickelt, manche Polizisten sind korrupt, andere strunzdumm, wieder andere beides, es existieren natürlich sowohl eine abgelegene Jagdhütte als auch ein Konto auf den Cayman-Inseln – um nur einige zu nennen) und die häufigen Logikfehler auf (eine einzelne Frau befördert gleich mehrere männliche, zum Teil beleibte Leichen aus dem Kofferraum in ein von ihr selbst ausgehobenes Grab, aus einer kleinen roten Pfütze Blut auf dem Asphalt wird ein paar Seiten weiter plötzlich „ziemlich viel Blut“, im Handschuhfach wird ganz selbstverständlich der FahrzeugBRIEF aufbewahrt…). Darüber hinaus bleibt die Handlung ähnlich wie die Charaktere recht eindimensional. Weder erfährt der Leser Interessantes zur Ermittlungsarbeit, noch wird die Kölner Unterwelt näher beleuchtet. Gerade Letzteres hätte sicherlich Stoff für eine spannende Nebenhandlung geboten. Ein wenig scheint es, als hätte der Autor nicht viel Zeit für Recherche aufgewendet, sondern die Geschichte einfach schnell herunter geschrieben.
Der Schreibstil ist dabei sehr einfach gehalten und zeichnet sich durch den einen oder anderen Rechtschreibfehler sowie zahlreiche Wortwiederholungen aus. Der Lesefluss wird an einigen Stellen durch diverse Lautmalereien unterbrochen. So wird eine Ohrfeige durch „KLATSCH“ und das Schießen mit Schalldämpfer durch „PLOPP“ verdeutlicht. Solche Stilmittel gehören in einen Comic, nicht in ein Buch, schon gar nicht mehrfach und auf so platte Weise. Wie in vielen anderen Krimis und Thrillern wird in diesem ebenfalls Gebrauch von der Wendung »Im nächsten Augenblick brach die Hölle los« als vermeintlichem Cliffhanger am Kapitelende gemacht. Will sagen: Auch sprachlich greift der Autor tief in die Klischeekiste. Den angeblichen schwarzen Humor des Buches sucht man indes vergeblich, ebenso wie jegliche sonstige Komik. Was man stellenweise findet, sind einige bemühte, ziemlich plumpe und daher gescheiterte Versuche, witzige Dialoge einzubringen. Insgesamt ist das Buch sehr emotionslos geschrieben; es fehlen sprachliche Feinheiten und Spielereien. Dementsprechend wird kein buntes, lebendiges Bild gezeichnet, sondern schlicht Satz an Satz gereiht.
Zum Ende hin wiederholt sich die Handlung nur noch – und das gleich mehrmals. Das Finale ist erneut klischeebeladen und zudem vorhersehbar.
Fazit: Aus der Grundidee von „Fünf Millionen Lösegeld“ hätte sich viel machen lassen – bedauerlicherweise gelingt es dem Autor aber nicht, eine stimmige, spannende und ausgefeilte Geschichte zu erzählen. Flache Charaktere werden in extrem kurzen Kapiteln durch eine oftmals unlogische und vorhersehbare Handlung voller Klischees gejagt. Leider also dieses Mal keine Leseempfehlung.
Cover © Edel Elements
- Autor: Thomas Kredelbach
- Titel: Fünf Millionen Lösegeld
- Verlag: Edel Elements
- Erschienen: 05/2017 (Taschenbuch bereits 04/2010)
- Seiten: 229
- ISBN: 978-3832-1611-32
- Sonstige Informationen:
Erwerbsmöglichkeiten
Wertung: 1/15 Lösegeldforderungen für die Grundidee