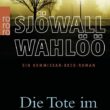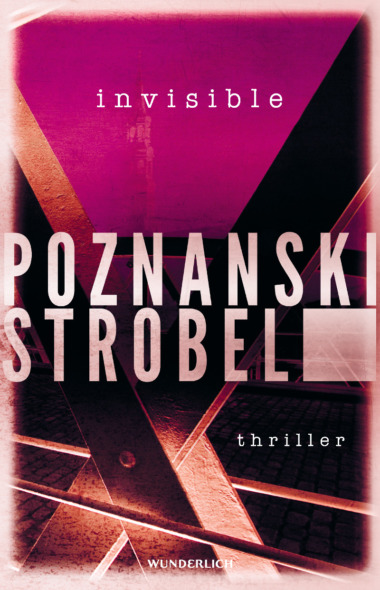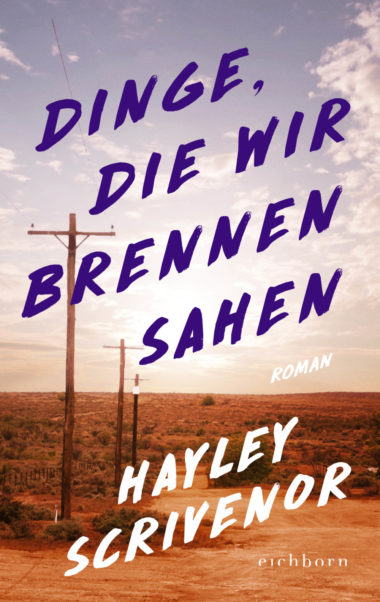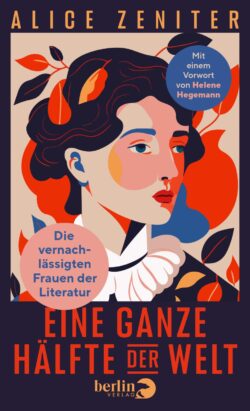
Die französische Autorin Alice Zeniters hat mit Eine ganze Hälfte der Welt ein kluges, tiefgehendes und zugleich unterhaltsames Werk geschaffen, das die Literatur vor allem aus der Perspektive der Lesenden hinterfragt. Zeniter reflektiert nicht nur über die Rolle der Frau in literarischen Werken, sondern auch über Genres, den Roman als narratives Konzept und analysiert, welche Strukturen es Autorinnen erschweren, sich frei von vorgegebenen Mustern zu bewegen.
„Die durchschnittliche Diskrepanz zwischen dem gemeldeten Einkommen von Autoren und Autorinnen beträgt 24 Prozent (sehr viel mehr als der durchschnittliche Gehaltsunterschied, der sich in Frankreich auf etwas 17 Prozent beläuft). Frauen erhalten zudem niedrigere Fördersummen als Männer, wenn sie sich um Literaturstipendien bemühen. Sie werden seltener auf Buchmessen und Festivals eingeladen …“ (S. 83)
Bereits zu Beginn von „Eine ganze Hälfte der Welt“ setzt sie sich mit dem Begriff “Frauenliteratur” auseinander und stellt die Frage, ob es sich hierbei um eine eigene Kategorie oder lediglich um ein abwertendes Etikett handelt. Diese Diskussion erinnert stark an Nicole Seiferts Werk Frauenliteratur, das sich mit der Bedeutung und Problematik des Begriffs auseinandersetzt. Zeniter geht jedoch erzählerischer vor und verbindet ihre Reflexionen mit literarischen Beispielen sowie eigenen Erfahrungen. Sie beleuchtet, wie weibliche Figuren in der Literatur geformt werden und welchen Einschränkungen sie unterliegen. Dabei greift sie unter anderem den Bechdel-Test auf, der den Mangel und das Fehlen von Frauenfiguren mit eigenen Handlungsbögen verdeutlicht, und geht noch weiter mit dem “Sexy-Lamp-Test”. Dieser hinterfragt, ob eine weibliche Figur so unbedeutend ist, dass sie durch eine Lampe ersetzt werden könnte (Spoiler: Es funktioniert erschreckend oft). Wenn sie sich in Kapiteln, wie „Potenzparade“ darüber auslässt, dass das Schreiben seit jeher etwas sehr heroisches, männliches und als eine Art Kraftakt verstanden werden kann, ist man beim Lesen nicht selten zwischen einem Lachen und schockiertem Innehalten hin- und hergerissen.
„Romane zu schreiben, wird als eine Art feiges Versagen betrachtet und ist nur dann männlich, wenn es etwas einbringt – Geld ist männlich. Ebenso Alkohol.“ (S.91)
Zeniters Quellen sind vielfältig und meist in der französischen Literaturszene verortet. So bezieht sie sich oft auf den Paris Review. Auch nimmt sie immer wieder Gedanken der Autorin Toni Morrison auf, insbesondere wenn es um die Dekonstruktion von Frauenfiguren in ihren eigenen Werken geht. Die Verknüpfung von literarischer Analyse mit persönlicher Selbstreflexion ist ein weiteres Merkmal, das Zeniters Werk auszeichnet. Immer wieder hinterfragt sie sich selbst als Leserin und Autorin und zeigt, wie sehr ihr eigener Blick durch bestehende Strukturen geprägt wurde. Dadurch vermittelt sie einen sehr persönlichen und nahen Eindruck ihrer Sichtweise auf den Literaturbetrieb und ihr eigenes Wirken als Autorin.
Auch spart Alice Zeniter nicht mit Fußnoten. Diese lassen sich in ausgiebiger Form auf vielen Seiten finden. Das lockert den Text auf und bietet teils aufschlussreiche Zusatzinformationen, etwa wenn Zeniter theoretische Gedanken vertieft oder Literaturbeispiele anführt. An anderen Stellen wirken sie manchmal etwas holprig, insbesondere wenn sehr ausführliche Anekdoten aus ihrem Privatleben eingeflochten werden, die den Lesefluss unterbrechen können.
Die Rolle von Autorinnen und Leserinnen steht immer wieder im Fokus des Buches. In Kapiteln wie Potenzparade oder Autorin sein wird sie besonders stark thematisiert, während sie in anderen Passagen wie dem Kapitel „Roman as usual“ nur subtil mitschwingt. Letzteres beschreibt Zeniter als eine literarische Form, die sich erfolgreich wiederholt, nach einer originellen Handlung verlangt und Figuren präsentiert, mit denen sich Lesende identifizieren können. Sie hinterfragt, ob es für eine Autorin oder einen Autor überhaupt möglich ist, sich dieser Erwartungshaltung zu entziehen, ohne an Relevanz zu verlieren. Zeniter stellt die Frage, wie dieses Konstrukt aufgebrochen werden kann und ob es überhaupt sinnvoll ist sich diesem „Erfolgsrezept“ entgegenzustellen.
Insgesamt ist Eine ganze Hälfte der Welt ein sehr umfassender, persönlicher und aufgrund von Zeniters Schreibstil kurzweiliger Beitrag zur Literatur, der durch die humorvolle, kritische und reflektierte Herangehensweise der Autorin eine Lektüre bietet, die nachwirkt. Es ist eine Liebeserklärung an die Literatur, aber auch eine Analyse ihrer Mechanismen. Zeniters Begeisterung für das geschriebene Wort und ihre Lust am Erkunden von Literatur sind auf jeder Seite spürbar, was das Buch nicht nur lehrreich, sondern auch unterhaltsam macht.
- Autorin: Alice Zeniter
- Titel: Eine ganze Hälfte der Welt
- Originaltitel: Toute une moité du monde
- Übersetzerin: Yvonne Eglinger
- Verlag: Berlin Verlag
- Erschienen: 2025
- Einband: Hardcover
- Seiten: 256
- ISBN: 978-3-8270-1500-6
- Produktseite
- Erwerbsmöglichkeiten

Wertung: 12/15 dpt