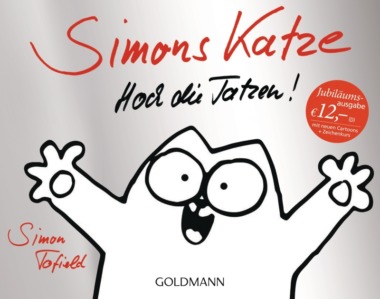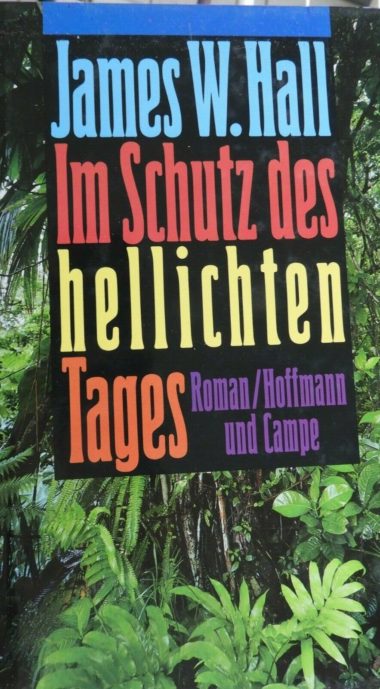Der Jahresrückblick 2021 von Jochen König
Alle guten Wünsche zum neuen Jahr wurden schnell hinfällig, Corona dominierte auch 2021. Als wäre die Pandemie selbst nicht schon übel genug, positionierten sich seltsame Gruppierungen von Realitätsverweigerern, „Vorsorgeskeptikern“ und strammen Faschisten und brüllten laut ihre unmaßgeblichen Meinungen heraus. In denen es meist darum ging, dass Geschichte umgedeutet wurde, die kindliche Trotzphase verlängert wurde und Meinungsfreiheit mit Deutungshoheit verwechselt wurde. Eine Querbefindlichkeitsparade aus der Hölle, das pure Armutszeugnis.
Sinniger wäre ein Arrangement mit den Umgebungsparametern, sorgsamer Umgang mit Kontakten und größeres Augenmerk auf kulturelle Kleinodien, die daheim genossen werden konnten. Konzerte fielen leider 2021 komplett flach oder wurden weit verschoben. Immerhin gab es eine fantastische Ballettaufführung zu sehen und hören. Das portugiesische Quorum-Ballett tanzte faszinierend zu Jorge Silvas perkussiven, elektronischen Klängen sowie Igor Stravinskys „The Rite Of Spring“. „Made In China“ verband gekonnt Klassik und Moderne.
In der zweiten Jahreshälfte gewann Kino wieder an Präsenz. Abstände konnten halbwegs eingehalten werden, im letzten Viertel war 2G die Regel. Ein Highlight des Jahres war „The Father“ mit einem famosen Anthony Hopkins in der Titelrolle, adäquat umsorgt von Olivia Colman und der sehr geschätzten Imogen Poots. Das Demenz-Drama aus konsequenter Krankensicht funktionierte als ergreifende Charakterstudie wie als komplexer Thriller. Keine jämmerliche Schmonzette mit Honig im Kopf, sondern Höhepunkt eines schwierigen Kinojahrs.
„Dune“ war ein Film fürs Kino, der zu gleichen Teilen gefiel wie nervte. Bilder und schauspielerische Leistungen waren ein Fall für die große Leinwand, die Story nervte im Erlösermodus wie eh und je, und litt – unverdient – darunter, dass Filme wie „Star Wars“ oder Serien wie „Game Of Thrones“ bei „Dune“ gelernt haben. Ein störender Nervfaktor war die ständige Hans Zimmer-Musikberieselung, die selbst eine schlichte Umzugsaktion zum majestätischen Akt hochstilisierte. Nicht ganz so toll auch, dass die schnell geschnittenen Kampfszenen in dem ansonsten langsamen Film offensichtlich auf ein juveniles Publikum ausgerichtet waren.
Hans Zimmer versorgte auch den lang hinausgeschobenen „Keine Zeit zu sterben“ mit Musik, den letzten Film mit Daniel Craig im James Bond-Modus, fällt hier aber nicht unangenehm auf. So richtig gelungen ist das viel zu lange Werk nicht. Wer 007, zumindest partiell, als Jammerlappen erleben möchte, dazu mit Remy Malek einen blassen, geschwätzigen Bösewicht im Schlepptau, der ist hier richtig. Reichte in Deutschland für den erfolgreichsten Film des Jahres. Weltweit sieht es eher mau aus. Besser als „Spectre“, was nicht schwer ist, aber zerfasert und inkonsequent. Die weibliche 007-Nachfolgerin bleibt eine bloße Behauptung, am Ende muss der „wahre“ Bond wie üblich die Welt retten. Mit Stoffhäschen im Hosenbund. Was der Figur den Rest gibt.
Lohnend vor allem wegen des Kurzeinsatzes der wunderbaren Ana Des Armas (harmonierte schon in „Knives Out“ hervorragend mit Daniel Craig), die dem alternden Agenten mit Schwung, Eleganz und Witz zeigt, wie’s geht. James Bond hat als konservative Ikone der Popkultur seine Berechtigung, ein Relikt ist er seit Jahrzehnten, da braucht es keinen sorgenzerfurchten Craig zum Beleg. Gebrochene Antihelden gibt es an jeder Straßenecke, von Jason Bourne bis Batman, das Bond-Franchise hätte besser auf schwarzen Humor und 007s Qualitäten als Stehaufmännchen setzen sollen. So bleibt mit „Casino Royale“ ein starker Ersteinsatz und der Wunsch, dass es beim (irgendwann) kommenden Reboot wieder bergauf geht mit dem Schüttelfaktor.
Richtige Höhepunkte gab es mit Filmen, die kaum oder gar nicht im Kino liefen. Wie dem düsteren, stimmungsreichen Okkult-Kammerspiel „A Dark Song“ aus Wales, der zwischen „Mandy“ und den „Muppets“ pendelnden Horrorgroteske Willy’s Wonderland“, in der der stoische und schlagkräftige Nicolas Cage kein einziges Wort spricht, aber immer auf die Einhaltung der Arbeitspausen achtet. Peter Strickland fabrizierte mit „Das blutrote Kleid“ („In Fabric“) eine alptraumhafte Mischung aus Giallo-Hommage und Konsumkritik, mit einem höchst ansprechenden Soundtrack von CAVERN OF ANTIMATTER.
Zudem gab es von Camera Obscura, Turbine Medien, Koch Media und anderen sehr lohnende Ausgrabungen. So überzeugte „Electra Glide In Blue“ („Harley Davidson 344“) in jeder Hinsicht, Koch Media hatten nicht nur feine Italo-Western im Gepäck, sondern auch amerikanische Klassiker der unterschätzten Art wie John Sturges Psycho-Western „Backlash“ („Das Geheimnis der fünf Gräber“).
Eine erfreuliche Überraschung zum Jahresende bildete die australische Studie in Traurigkeit, “The Dry”. Ein düsterer Country-Noir, in der die Vergangenheit mit der Gegenwart kollidiert und eine starke Geschichte um kleine und große Lügen, tödliche Verstrickungen und Vergebung erzählt. Visuell exzellent umgesetzt, stark besetzt, allen voran brilliert Eric Bana, der Verletzlichkeit und Schuldgefühle ganz fabelhaft hinter scheinbarem Stoizismus verbergen kann. Dazu ein hervorragender Soundtrack, gekrönt von einer herzerweichenden Interpretation des THE CHURCH Klassikers “Under The Milky Way”.
Sehenswert war auch der klaustrophobische Kriegsfilm „The Outpost“, der angesichts des überstürzten Abzugs internationaler Truppen aus Afghanistan, einen noch bittereren Nachgeschmack bekommt, als dieser Kampf auf verlorenem Posten eh schon besitzt.
In der Warteschleife stecken noch „Titane“, Brandon Cronenbergs „Possessor“, „The Censor“, „The House Of Gucci“, „Free Guy“ (mittlerweile gesehen und für höchst spaßig befunden. Ryan Reynolds ist ein Selbstläufer, Jodie Comer wie üblich eine Wucht, die Witze sitzen, die Action ist sorgsam verteilt und Chris Evans hat einen starken Auftritt) und einige andere verpasste Werke. Besondere Schmankerl: Die 4K-Version von David Lynchs „Mulholland Drive“ und Ari Asters „Midsommar“ inklusive Director’s-Cut auf dem Gabentisch.
Seriell sorgten nicht nur aktuelle Produktionen für Freude. Endlich „Justified“ komplett angesehen. Begeistert gewesen. Lakonisch, witzig, herzzerreißend traurig, voll cooler Action und Dialogen zum Eintätowieren. Dazu ein extrem stimmiger Cast ohne Schwachstellen. Ganz vorne natürlich Timothy Olyphant und Walton Goggins, als die berüchtigte Medaille mit den zwei Seiten. Und wieder einmal Kaitlyn Dever, die weit vor „Unbelievable“ klarstellt, dass mit ihr immer zu rechnen ist.
Ebenfalls punkten konnte „Southland“, die Cop-Serie, die bei ähnlicher Erzählweise immer etwas im Schatten von „The Shield“ und „The Wire“ stand. Zu Unrecht, denn die Geschichten um Streifencops, Detectives, Gangs und individuell produzierte Alltagsgewalt können auf ganzer Linie überzeugen. Politische und persönliche Implikationen inklusive.
Die erschlagende Vielfalt aktueller Serienschöpfungen führt fast zu Buridans Eselsdilemma. Verhungern zischen zu vielen Heuhaufen. Von denen allerdings bei weitem nicht alle schmackhaft sind.
Gemundet haben aber „Falcon and the Winter Soldier“, gediegene Action mit Witz und etlichen Camp-Momenten, unterhaltsamer als einige Marvel-Kinofilme. Was, wenn auch bei gänzlich anderer Herangehensweise, für „Wandavision“ und „Loki“ gilt. Zum Jahresende bekam endlich „Hawkeye“ aka der „Ronin“ seinen verdienten Fernsehauftritt. Und Jeremy Renner mit der einnehmenden Halee Steinfeld eine würdige Partnerin/Nachfolgerin. Florence Pugh („Midsommar“ again) taucht auch auf. Was uns natürlich sehr erfreut. Geschick bei der Besetzung beweist das MCU eindeutig. „Hawkeye“ ist dabei hochunterhaltsam. Es hätten ruhig mehr als sechs launige Folgen sein dürfen.
Gefallen hat ebenfalls „There Is Only Murder In The Building“, das artifizielle, melancholische-Whodunnit von und mit dem verlässlichen Steve Martin. Im Verbund mit dem aufgekratzten Martin Short und der etwas gegen den Strich gebürsteten Selena Gomez, die perfekt mit den Grandseigneurs harmoniert. Charmant und stilbewusst. Das sind auch, wenn auf ganz andere Art, die „Murdoch Mysteries“ aus Kanada. Dort gibt es bereits fünfzehn Staffeln, hierzulande wurde gerade die erste Staffel veröffentlicht. Ein historischer Krimi, der gekonnt in die Moderne schielt. Das ist auf entspannend-spannende Art unterhaltsam, die Besetzung stimmt und der Umgang mit dem begrenzten Budget ist … kreativ. Keine Neuerfindung des Fernsehens, aber genau das, was man mitunter zum Tagesausklang braucht.

Kein Weg vorbei ging an „Squid-Game“, dem Netflix-Mega-Erfolg aus Südkorea. Plakative, brutale Sozialsatire, die erstaunlich treffend soziale Dissonanzen und Verhaltensweisen anprangert. Konsequent und mutig, dass der sympathischste Charakter stirbt, während der Gewinner der tödlichen Show nicht Darwins erste Wahl gewesen wäre. Angefüllt mit popkulturellen Verweisen, bis hin zur Pier Paolo Pasolinis „Salo oder die 120 Tage von Sodom“ bietet die Serie spannende, partiell nachdenkliche Unterhaltung. Neu ist daran allerdings nichts, Nicht nur „Das Millionenspiel“ und „Battle Royal“ haben ein ähnliches Feld bereits Jahrzehnte vorher beackert. Dass Grundschüler die Serie in den Pausen nachspielen, lässt allerdings auf mangelnde Aufsichtspflicht schließen. Denn eine Kindersendung ist „Squid Game“ definitiv nicht. Es gibt Menschen, die ziehen die thematisch ganz ähnlich gelagerte japanische Serie „Alice in Bordertown“ vor. Kann man machen, ich habe es nicht bis zur letzten Folge geschafft. Was nicht an der Qualität liegt, sondern weil mir ein zivilisatorisches Untergangsszenario neben der Realität reicht. Vielleicht irgendwann mal eine Komplettierung. Aber nicht jetzt.
Literarisch war erneut James Sallis mit seinem Roman „Sarah Jane“ ein stilsichere Bank: „James Sallis gelingt es wieder auf rund 200 Seiten ein kleines Universum zu erschaffen. „Er konnte den Peloponnesischen Krieg in einem Satz zusammenfassen“, heißt es an einer Stelle. Das trifft auch auf den Autor zu. Sallis gelingen Lebensabrisse in wenigen Sätzen, selbst bei Figuren, die nur am Rande auftauchen. […] Sallis beherrscht die Kunst der Komprimierung. Zugleich poetisch und treffgenau gibt er seinen Lesern Raum, das brennende Unausgesprochene zu füllen und den Text weiterzuentwickeln. Bloße Ermittlungsarbeit und stereotype Spannungsentwürfe spielen dabei kaum eine Rolle. Spannend ist die Sicht Sarah Janes aufs Leben, auf Möglichkeiten, Verweigerungen, verpasste Chancen und die ewig lauernde Unbehaustheit. Die menschliche Existenz als Monster, das sich selbst verspeist.“ (Aus meiner Rezension für Stefan Heidsieks Crimealley-Blog)
Sehr fein war zudem „Frostmond“, das bei Pendragon erschienene Debüt von Frauke Buchholz über die Mordserie an indigenen Frauen entlang des kanadischen Highways 16, besser bekannt als „Highway of Tears“.
„Frostmond ist ein stilistisch präzise artikuliertes, formal und inhaltlich ausgereiftes Debüt. Die verschachtelte Erzählweise fordert die Leserschaft; ein Abgleiten in die Untiefen des herkömmlichen Serial-Killer-On-The-Loose-Krimis vom Grabbeltisch vermeidet Frostmond gekonnt.“ (Kritik auf Krimi-Couch.de)
Weitere Favoriten sind die Autobiographie Mark Lanegans, der ziemlich schonungslos und nachtschwarz mit sich und seinen Kollegen und Freunden abrechnet, John Mairs „früher existenzialistischer Roman“ (Eva König) „Es gibt keine Wiederkehr“, die erneute Beschäftigung mit Patricia Highsmiths exzellentem „Das Zittern des Fälschers“, erstmals in der ungekürzten Neuübersetzung, „Future Sounds – Wie ein paar Krautrocker die Musikwelt revolutionierten“ von Chrisszoph Dallach, als Würdigung des ursprünglich despektierlich gemeinten Begriffs „Krautrock“ und der dazugehörenden Musik. Passend zur pandemischen Zeit „Das kleine Weltuntergangs-Lesebuch“ aus der Edition Phantasia „Die schwarze Grippe“.
Die Musik des Jahres 2021 gehört in erster Linie Veteran*innen. Pharoah Sanders veröffentlichte mit Floatings Points und dem LSO ein höchst stimmungsvolles „Promises“ vor, ebenso klasse Charles Lloyd & The Marvels mit dem überzeugenden „Tone Poem“. The The bescherten uns „The Comeback Album“ und klangen als wären sie nie weg gewesen, was noch mehr für die Wiederauferstehung ABBAs gilt, die mit „The Voyage“ nicht nur Corona sondern die letzten 40 Jahre vergessen ließen. Das weiß ganz sicher auch Steven Wilson zu schätzen, dessen „Future Bites“-Album den ein oder anderen Progger arg verschreckte. Recht so. Mit dem Silver Surfer auf nächtlichen Trips durch die Roller-Disco. Nick Cave & The Bad Seeds präsentierten endlich Part II der „B-Sides & Rarities“ und zelebrierten eine durchweg gelungene Schwarze Messe. Direkt aus dem Jahr 1975 schließlich stammt das Doppelalbum von CAN, die Aufnahme eines Konzerts in Stuttgart. Eine klanglich fein herausgeputzte hypnotische Reise in die Vergangenheit und wieder zurück.
Eines meiner Top-Alben des Jahres stammt vom Tiger aus Wales, Tom Jones, der sich würdig auf den Spuren Scott Walkers an Cover-Versionen versucht. Nicht versucht, sie grandios bewältigt.
Aktuell und dennoch die Vergangenheit immer im Blick haben die mexikanischen Rider Negro mit ihrem psychedelisch rockenden „The Echo Of The Desert“. Nicht nur stimmlich sind THE DOORS die prägenden Schatten an der Wand. Ein Wüstenritt vom Feinsten.
Logan Richardsons „Afrofuturism“ ist ein faszinierendes Werk, das gekonnt Modern Jazz, nachtschwarze Elektronik und verfremdeten Blues präsentiert, voller zeit- und gesellschaftskritischer Bezüge. Ähnlich, nur einen Hauch heller und sentimentaler zeigten sich Orlando Le Fleming + Romantic Funk auf „The Unfamiliar“. Fusion von flackernder Intensität, die an die besten Momente Marcus Millers und den späten Miles Davis erinnern.
Trotz (oder wegen) Corona war 2021 produktiv.
2022 kann kommen. Mit gespannten Wünschen bin ich vorsichtig, das hat 2020 auch nicht hingehauen. Also halte ich es weiter mit Special Agent Dale B. Cooper:
Immer noch eine hohe Erwartung in einer bizarren Zeit.