Destruktiver Sinnlichkeitskonstruktor
|Das lyrische Werk von Andrascz Jaromir Weigoni [im SCHUBER]
Ein Rezensionsessay – sogar mit zwei Epigraphen:
Dare Mighty Things
Teil eines bekannten Zitates Theodore Roosevelts (26. Präsident der Vereinigten Staaten) und inoffizielles
Motto des Jet Propulsion Laboratory / California Institute of Technology
Plato machte es sich einfach. Als er darüber nachdachte, woher ein Dichter seine Einfälle nimmt, kam er zu dem Schluß, der Musensohn sei eben heilig und spreche ›nicht kraft einer Kunst, sondern durch göttliche Macht‹.
Jochen Paulus (Die Zeit)
Es ist einfach Der Schuber1 Vom Ding zum Symbol. Vom Symbol zum Begriff. Vom Begriff zum Kult. Der Schuber, das wird eines Tages unter Lyrikkennern der initial code zur Weigoni-Zone sein, sobald es um das Sujet und um den Stoff selbst geht.
Irgendwo in der beachtlichen Menge der essayistischen Sekundärliteratur über dieses kraftvolle Lyrikpaket bereits in dessen Erscheinungsjahr las ich: Lebenswerk! Das klingt gut. Bombastisch. Monströs auch. Beklemmend zugleich; so abschließend, gültig, end-gültig. Die luftig frischen 59 Lebensjahre dieses phänomenalen Kompositors A. J. Weigoni lassen uns Raum genug, auf Fortschreibung und Fortsprechung des Kontinuums seiner beispiellosen VerDichtungen zu hoffen.
Sagen wir also: eine Werkschau (eine lyrische) – ein Werk bis dato, die Summe und Quintessenz des Vorhergegangenen – wird uns hier vorgelegt, eine eigenwillige Werkausgabe, in der Edition Das Labor aus Mülheim. Fünf Gedichtbände in limitierter und handsignierter Ausgabe, zusammen mit dem auf vier CDs erweiterten Hörbuch, das sämtliche Audioeinspielungen bietet, die zwischen 1995 und 2015 im Tonstudio an der Ruhr in Zusammenarbeit mit dem Komponisten Tom Täger, noch heute ein prägender Kopf in der Mülheimer Musikszene, entstanden sind, präsentiert in einem robusten Schuber aus schwarzer, genieteter Kofferhartpappe; die materiellen Fakten gleich vorneweg. Als Cover ist auf jedes der weißen Bucheinbände ein Holzschnitt des Neheimer Künstlers und Schriftstellers Haimo Hieronymus direkt aufgestanzt, mit ihrer Farblichkeit und individuellem Charakter zu visuellen Markierungen, zu Signifikanten werdend und die Bücher als Zeichenträger, als deren Signifikate vereinnahmend. Mitteilend zeichenhaft auch das Titelfoto auf der schlichten CD-Multibox (eine DVD-Hülle) aus schwarzem Kunststoff: ich glaube da einen divino artista zu sehen, Schattenriss und Pose Albrecht Dürers, Symmetrie und Frontalansicht, Selbstbildnis ohne Pelzrock: Andrascz Weigonius Aquincus / ipsum me propriis sic effin / gebam coloribus aetatis.
Die hierarchische Pose ist eine Idealisierung, ein starkes Stück, ein ironisches Zitat vielleicht oder die Dekonstruktion des Künstlers als menschgewordener Urheber, dessen imaginativer Schöpfungsakt die dynamische Selbstsetzung des göttlichen Geistes wiederholt.
Schuber, Bücher, CDs, Hartpappe und der Dichter mit der Lockenmähne, an einen reifen Rockstar erinnernd, hier ist alles schnörkellos, direkt, artisanal, greif-bar. Und bevor es ans Befühlen, Durchblättern und Reinhören geht, soll hier eines klargestellt sein: Ich werde – wie man bereits gesehen hat – mich nicht mit der Floskel »der Autor dieser Zeilen« unkenntlich machen, und ein Ausweichen in den Plural der Dritten Person wird die Ausnahme bleiben und lediglich der Verbildlichung eines abstrakten Kollektivs aus Lyriknerds, jener sozial-defizitären, Gedichte lesenden Minderheit, hinter mir oder um mich herum dienen (muss übrigens ein Nerd soziale Defizite haben? – zählt Lyrikaffinität zu diesen Defiziten? [»Positiv betrachtet ist ein Nerd ein Individualist, der durch Besitz hinreichender Fachkenntnisse einen entsprechenden Grad an gesellschaftlicher Anerkennung innerhalb der jeweiligen Szene aufweist.« Danke Wiki!] – Überlegungen hierzu überlasse ich Ihnen). Überhaupt: Welche Form für meinen Beitrag zum Schuber? Bin ich hier wahrhaftig so wichtig? Eine Stilfrage, ich weiß, doch wie kann sich ein Leser/Hörer aus der Poesie, zu der er sich einmal, lesend/hörend translativ seine Beugung vor dem Werk vorwegnehmend, gesellt hat, deren Teil er geworden ist, neben dem diaphanen Bild des Dichters dort plötzlich hineinreflektiert, – wie also soll er sich da wieder herausretouchieren? – wie sich aus Figurenwelt und Interpretation zurückziehen? – wie sollen Aussagen eines Subjekts unter Subjekten strikt objektiv sein? Außerdem wäre eine schulmäßig umgesetzte Rezension unpassend; diese Werkschau, die ich mir und geneigtem Leser erschließen möchte, insbesondere den Hörbuchteil, empfand ich – gleich beim Erkunden der ersten CD – als zu persönlich. Persönlich mich ansprechend und – als Nebeneffekt – mich das Zuhören (wieder) lehrend. 270 Minuten Spieldauer werden einem da zugemutet und keine einzige dieser Minuten wird später bereut werden, irgendwo fehlen. Gleich so umfassend, einnehmend, schlich mich da die »sanfte, wohllautende Stimme …« (»… ist für mich immer einer der größten Zauber der Erscheinung gewesen«, wie Malwida von Meysenbug, die erste für den Literaturnobelpreis nominierte SchriftstellerIN in ihren Memoiren einer Idealistin schreibt) der vorstellbaren Präsenz des Rezitators an, dass einige Sätze untergingen in meinem ängstlichen ersten Moment: »Schlagt ihn tot, den Hund! Es ist ein Rezensent.« An mich dachte ich und an Goethe, was keinerlei poetischen Bezug hatte, weder zwischen Weigoni und mir oder Goethe und Weigoni oder Goethe und mir, zunächst, es war vielmehr der Zweifel, ob ich jemals eine Stellungnahme, eine Betrachtung, einen … – Diskurs (? – ich bin noch immer unentschieden) über diesen (Mikro-)Kosmos aus Überschreibungen unseres gewohnten Sprachcodes und phonetischer Durchdringung auf ein paar läppischen Seiten zustande bringen und – sagen wir es frei heraus, denn das ist mein Anliegen: würdigen könnte.
Welche Vorgehensweise war zu wählen? Noch einmal: welche Form? In distanzierter Weise eine Art Pressetext kompilieren? Kompakt und ausgewogen? Mit der meistens einhergehenden öden Alltäglichkeit des Niveaus einer Zeitungsspalte (und dem Versetzspiel aus Kollegenzitaten)? Eine Rezension? Überschattet vom Risiko des immer unvermeidbar – und sei es unterschwellig – erhobenen Zeigefingers des Kritikers? Der Lyrikhimmel bewahre mich davor; nicht mit Weigoni, nicht mit der genial metaphernden Autorität der schöpferischen Dissonanz. Außerdem kommt Rezension von recensio: Musterung – noch schlimmer, im ursprünglichen Kontext die Musterung der (römischen) Bürger durch den Zensor meinend, und ist als literaturkritische Gattung mit allerlei schulmeisterlichen Restriktionen versehen – zum Beispiel: bringt ein Rezensent persönliche Züge in den Text, provoziert er persönliche Reaktionen anderer, des rezensierten Autors oder der Leser – der Text hat dann das Zeug zum Streit; eine Rezension ist keine Meinungsäußerung des Verfassers derselben; nur positive Kritik wirkt unglaubwürdig; Wertmaßstäbe zu explizieren ist überflüssig.
Unbefangen, naiv – gespielt naiv, denn nicht erst seit Hans-Georg Gadamers Wahrheit und Methode sollten wir uns stets unserer eigenen Vorurteilsstruktur bewusst sein – möchte ich mich durch das Phänomen Weigoni hören und lesen und jedes Obstakel, das sich mit dem Anschein von Bewertungsfeuilletonismus in den Weg stellen mag, weit umgehen. Erst A. J. Weigoni, dann ich. Oder erst ich und dann A. J. Weigoni. Wem´s nicht passt, der lese woanders. Also sei es: flugs zwei Wörter vereint, zwei Dinge zusammengefügt, denn das eine für sich und das andere alleine – nein, das entsprach nicht wirklich dem Anspruch an die Form, die mein Anliegen transportieren sollte. Nun war ich mir absolut sicher gewesen, dass ich etwas erfunden hätte: den Rezensionsessay. Renzension/Essay. Ergibt: Rezensions-Essay. Doch Google machte mir, nach Minuten des Schöpferglücks, einmal mehr eine lange Nase, weil: feuilletoniert und zu Diskursen der kritischen Auseinandersetzung erweitert sei der sogenannte Rezensionsessay seit dem 17. Jahrhundert eine bekannte Ausdrucksform, las ich dort. Man lernt nie aus. Diskurs. Umherlaufen. Diskursen wir also. Bewegen wir uns durch die amazing wold of Weigoni, lassen wir ihn sprechen, lesen wir hier und dort nach, um uns des korrekten Verständnisses eines sezierenden oder exuberanten Wortspieles zu vergewissern, und versuchen wir, noch einige Betrachtungen anzuregen, über die noch nicht von Dritten über den Inhalt dieses wahrscheinlich schon jetzt legendären Schubers geschrieben worden ist, und vielleicht Fragen zu stellen, die wir, glaube ich allerdings, spätestens nach mehrmaligem sehr genauem Hin-hören in die Sprechgesten A. J. Weigonis ohrenzwinkernd ebenda beantwortet finden. Ideal wäre, wenn ich die schmerzhafte Worthülsen-Diarrhöe vermeiden könnte, über die Weigoni himself in seinen Verweisungszeichen zur Literatur einmal anmerkte: Niemand weiß etwas, alle wissen dasselbe und schreiben voneinander ab; dies ist kein Kreis-, sondern ein Leerlauf. Diese Bedeutungssubstitution ist lediglich ein probates Mittel, Thesen über Literatur an das Ufer der Verständigkeit zu retten, auf dem man sie dann kritisieren, verwerfen, unterstützen, sich über sie aufregen oder freuen kann. Und ich werde selber als erlebendes Individuum zum Gegenstand der Darstellung, wie es Montaigne nicht scheute und es beispielsweise der neomarxistische Literaturwissenschaftler Peter Bürger als Bewohner der Jetztzeit in seinen exzellenten Essays vormacht.
Ich also, und immer wieder ich, weil der Essayist Denken in Bewegung zeigt und sich selber als geschichtliches, als erfahrendes Individuum zum Gegenstand der Überlegungen machen muss. Die mich kennen wissen und verzeihen: Parfois je suis trop bavard.
Ja schön und gut, es geht um das lyrische Werk von Andrascz J. Weigoni; warum also ist von Goethe und – könnte man meinen – von Jacques Derrida (versteckt unter der Tarnkappe des Dekonstruktivismus – siehe Titel – oder ist das nur eine Finte?) und von der Feministin Malwida von Meysenbug und von Montaigne und Peter Bürger die Rede? – und warum wird im Folgenden gar noch der Amerikaner Ambrose Bierce auftreten? – und was soll das hier erzählende Ich, das nicht Weigoni ist und ebenso wenig neutraler Journalist oder einfach Hörer oder Leser sein kann und dem erst recht die Chuzpe fehlt, sich zum Kollegen aufzuwerfen. (Prokataleptisch ist dies schon hinreichend entschuldigt und die Absicht hinter der umständlichen Struktur wird irgendwann zu Tage kommen.) Dieses Ich ist nicht im eigentlichen Sinn auktorial, es ist Teil des Geschehens aber es weiß nicht alles, es ist ein Hörer, ein Leser, und es ist – obschon ein Basiswissen um den Artisten Weigoni und wenige seiner Arbeiten besitzend – ein Entdecker. Neugier und Erwartung sind groß und werden nicht enttäuscht. Hier soll keine Selbstentäußerung stattfinden, nur eine Begegnung. Aber … der Reihe nach.
Also nun endlich, nach 8813 Zeichen(!) der Causerie (nennen wir es vergebliche Suche nach einer Kurzdefinition der quinta essentia – exklusive Leerzeichen und Überschrift), das Ereignis: Henry Thoreau war nicht nur ein Philosoph des zivilen Ungehorsams sondern ist auch ein Chesterfield-Sessel (zertifiziert) aus der Werkstatt Fleming & Howland in der englischen Grafschaft Lancashire: massives Innengestell aus Hartholz, Spiral- und Schlangenunterfederung, geschichtete Füllung auf handgenähter Musselinpolsterung, mit Anilin-Kuhhäuten bezogen, handgenäht, handgefärbt und mit diesen seltsamen eingeschlagenen Ziernägeln (von Hand müssen jene versenkt werden) versehen, alles in allem very british und mein Stolz, mein Thoreau, so weichgekuschelt von ungezählten Lektürestunden und nun, folgerichtig, der ideale Mittelpunkt meines Banachraumes, dessen vollständige Norm unendlichdimensionale Aufmerksamkeit sein soll.
Meinen Fantastic Flowers Porzellanbecher (Mug) mit dem dampfenden Jasmintee (White Hair Monkey) in der rechten Hand, mit der linken die erste Scheibe (Schmauchspuren lese ich in Tiefschwarz auf Silber) in den Schlund des Revox Joy gestupft und sofort zieht das Navigationssystem meine Sinne in die Aramidfasermembranen der Re:sound S prestige Boxen (Alu); Landpartie, space-filling; ja, Sinne – ich starre unvermittelt auf das Abspielgerät, das Auge hört mit. Notate fürs Auge, adressiert ans Ohr. (Theo Breuer) Die Nase folgt, es ist, als sähe ich die Hundskaule, als röche ich den Rhein. Wechselspiel zwischen Immanenz und Transzendenz, ein Sprache gewordenes Möbiusband, nicht orientierbar. Ich höre, wie man der Welt entkommt, indem man sich unmittelbar verschenkt und dabei den Augenblick der Anmut wiederherstellt. Es folgt eine Metaphorologie, in der Fußgänger zu Kopfgängern werden. Überfließende Seelen. Da werden mir Wörter vorgeführt, Denkspielereien im Zauberkreis der Sprache gleich. Hirnzonenreflexmassage zwischen Selbstvernichtungswollust und Vanitas-Symbolen. Was als scheinbarer Provinztrip im Rheinland, irgendwo zwischen Unkel und Remagen oder drumherum, beginnt, wird zur Dekonstruktion des Wirklichen und führt uns zu Silberküsten einer anderen Welt.
Performance im Wohnzimmer. Noch einmal hören. Jetzt gleich sofort. Und erst, als diese erste CD aus der Multibox zum zweiten Mal schweigt, nachdem ich mehrmals diese luziferische Selbst-Vernichtungs-Wollust vor mich hin gesprochen habe, ist es für mich der Auftakt zum Verstummen. Verstummen der Augen, der Nase, Verebben der Sinne, denn nun ist ein wenig Grübeln in eigener Sache angesagt.
Ich bin nun ein solcher Kopfgänger, werde das silbenwetzende Sprechtheater vom Beginn bis zum Ende systematisch hören, mehr analytisch als für Sprachsinnlichkeit empfänglich, in der nicht-chronologischen Reihenfolge der Anordnung der in der Multibox eingeklipsten Scheiben; eine nach editorischen Überlegungen zusammengestellte sinnfällige Abfolge, denn beispielsweise Schmauchspuren erschien zuerst in Buchform 2015, Unbehaust auf der zweiten CD kam 2003 in der Uräus-Handpresse heraus, Dichterloh (dritte CD) 2005 und so fort. Die Gedichte Der lange Atem übrigens wurden seit 1975 geschaffen bis sie als Die Schublade Nr. 19 im Bundesring junger Autoren 1985 als Buch vorlagen.
Es entstand also mit dem Schuber ein neues, unabhängiges Gesamtkunstwerk aus scheinbar heterogenen Elementen. Und unversehens stellt sich hier die Frage: zuerst lesen und dann hören? Oder erst hören und dann lesen? Vielleicht ein Mit-Lesen erproben, bevor ich mich an die Neige wage und weiter ins papierne Geknister von Unbehaust, während Weigonis Körperrede sich dichterloh entflammt und dringlich wird?
Mein Jasmintee ist jetzt kalt, verweht sein Duft, verzeihendes Opfer eines fanatischen Letternmusikers. Dazwischenkunft, ein Sound schwillt an, kaum merklich vermengt er sich mit dem Gesprochenen, drängt in die Sprache – aber nein, das schafft er nicht – die elektronische Musik von Tom Täger, in dessen Studio einst die ersten Aufnahmen des Jazzclowns Helge Schneider stattfanden, balanciert perfekt die Collage aus Text und Klang; es ist, als versuche sie die Aufhebung der Schwerkraft, um das Gesprochene seines Raumes zu entbinden. Sprachzeugkasten. Ich lausche den Worten der Zeit die vergeht. Und noch einmal Wörter, Sätze, die im Kopf bleiben: Schreiben – eine Kettenreaktion aus Sehen und Hören (und Fühlen und Riechen). Dann: Unbehaust. Unsere Vorstellung von Identität und somit Zugehörigkeit wird in diesem Monondram über die Freiheit des Einzelnen und die Unfreiheit der Bedingungen zergliedert. Hier überlässt Weigoni die Rezitation der Schauspielerin Bibiana Heimes: sie spricht aus dem Kopf der Jo Chang, einer asiatischen Einwanderin. Dieses Leben im Übergang wird zum zerbrochenen Traum; dem Sprachgeschehen sind Papiergeräusche unterlegt, dramaturgisch raffiniert verdoppelt sich von Zeit zu Zeit die Stimme, als würde das lyrische Ich vom empirischen Ich überlagert – ein Hall, der unangenehme Wahrheiten nachdrücklich akzentuiert; und – da ist noch mehr: Ist das ein Schreibstift, der auf harter Unterlage über Papier huscht, kratzt? Das Rascheln – ist es das Beiseitelegen beschriebener Blätter? Oder sind es Seiten, die zerknüllt werden?
Papier, so sieht es Weigoni, ist ein sinnliches Medium, das mit einem Geruch verbunden ist, das man fühlen und hören kann, auf ihm werden Noten, Gedanken und Skizzen notiert.
Ton, Töne, Geräusch, Stimme sind, würde ich sagen, ebenso sinnlich; Geruch und Gefühl können sich virtuell einstellen, in unserer Gedankenwelt, unserer Vorstellungswelt, die – wie jedes Lesen (und Zu-Hören), von einem eigentümlichen Vorwissen ausgeht, von Vorerfahrungen.
Manchmal klingt es in Unbehaust sogar, als spiele jemand auf einem dieser bemerkenswerten steinernen Instrumente – auf der Steinharfe oder der Klangschale – diesen Lithophonie-Objekten des österreichischen Bildhauers Kassian Erhart. Doch wir müssen wissen: Tom Tägers »komische Geräusche« werden ausschließlich mit Papier erzeugt. Sich gegenseitig auf den aktiven Widerstand vorbereiten … in innerer Immigration … Wahrnehmungsrausch … Ein Bild von der Welt zeichnen – wie? – wenn wir nur noch Fragmente vorfinden.
Glück ist (zuweilen) kein Vergnügen, wenn das Leben uns seine eigene Realität vorführt. Aus den Lebensentwürfen ins Nichts / Makulatur (tragisch) rettet Jo Chang sich mit ihrer poetischen Wahrheit. Das lyrische Ich wird zur Instanz.
Ein bisschen nebensätzliches gefällig(?): Dem Amerikanischen Zyniker und Meister paradoxer Stilfiguren Ambrose Bierce zufolge ist Wahrheit »die einfallsreiche Vermengung von Wünschbarkeit und Anschein« (The Devil’s Dictionary). Während mein Revox Joy CD Nummer Zwei ausspuckt, denke ich jäh, dass unser kompletter Ich-Begriff einer Vermengung von Wünschbarkeit und Anschein entspringt. Keine Erkenntnis – ich denke wieder daran, wenn ich Weigoni höre, diesen großartigen Spieler mit den Differenzen, der mit Sprache ja eigentlich so jongliert wie es Ferdinand de Saussure in seinen grundlegenden Definitionen einer modernen Linguistik dargelegt hat. Sprache sei »ein Ganzes von Beziehungen, das ein höchst variables Reales gebiert, ein Zeichensystem, das allein aus dem arbiträren Spiel von Differenzen besteht […]«. Das Ganze von Beziehungen wird von A.J. Weigoni tranchiert und zu poetischer Wahrheit à la bonne heure aus seinen eigenen Versatzstücken konstruiert – nicht re-konstruiert! – und dies ist der Flash, der mich zu Jacques Derrida führt: »Die Dekonstruktionen wären«, so Derrida, »schwach, wenn sie negativ wären, wenn sie nicht konstruieren würden«. Immer neu endet und beginnt die Dekonstruktion an Nullpunkten, an denen unaufhörlich Spuren auf andere Spuren verweisen und dadurch ein Raster bilden, in dem das Spiel der Verräumlichung stattfindet. Die Dekonstruktion ist also eine Konstruktion, die von destruktiven Operationen generiert wird. Die Bruchstücke dieser Operationen, Versatzstücke, sind Weigonis Bausteine. Versatzstücke selbstverständlich nicht im ursprünglichen Sinn als Bestandteile eines Bühnenbildes; denn Kulissengeschiebe ist eines der pop-modernen Phänomene, das der Künstler Weigoni scharf angreift (Verweisungszeichen zur Literatur).
Eine Zwischenbilanz, ein Zwischenbefund, drängt sich mir auf, eine erste Conclusio: Weigoni gelingt es, Wahrheit, wenn auch nicht direkt greifbar zu machen, so doch sie uns näherzubringen; sie bleibt nebulös, veränderbar, erneuerbar, relativ, doch wir können sie uns aneignen; eines jeden Wahrheit – noch einmal – wird zur Instanz. Poetische Wahrheit wird zu unserer Wahrheit, entsprechenden Interpretationsraum für jeden einzelnen lassend. Weigoni: ein Denkanstoßer auf der Suche nach Konvergenz von Kunst und Erkenntnis, ohne dabei Ideen aus zweiter Hand zu entwickeln.
Im phänomenalen Selbstmodell nach Thomas Metzinger erzeugt unser Gehirn eine Simulation der Welt, die so perfekt ist, dass wir sie nicht als ein Bild in unserem Geist erkennen können; dann generiert es ein inneres Bild von uns selbst als einer Ganzheit und dieses Bild umfasst nicht nur unseren Körper und unsere mentalen Zustände, sondern integriert es zu einem phänomenalen Selbst. Das phänomenale Selbst der Jo Chang entspricht ihrer poetischen Wahrheit. Obgleich es einigen Rezensenten zufolge in Unbehaust eben keine Conclusio gibt, wäre doch die Konstruktion eines Ich, das stark genug ist in der ästhetischen Zwischeneiszeit, in der Welt des grausamen Irrsinns, im moralischen Niemandsland (seelisch) zu überleben, eine erste Erkenntnis und nachahmenswertes Modell.
Weigoni öffnet Seelenräume; er und wir brauchen dafür nicht Dinge. Ist es nicht so, dass Sprache unser Leben formt? Degradieren nicht die Dinge unser Leben zur Ware? Entwürdigend.
Was wäre wenn … was wäre wenn ich gar keinen Revox Joy besäße? Wenn das Ding und seine Re:sound S prestige Boxen und die Aramidfasermembranen Fiktion wären? Tullsta Sessel (Ikea) anstelle des Chesterfield. Ein billiger Steingutbecher von Real. Fruchtige Waldbeere von Teekanne anstelle des White Hair Monkey. Wenn ich den Medion MD 4856 Discman von Aldi hätte? Und da den Weigoni einlege? Und ihn über billige In-Ear-Stereo-Kopfhörer mit Klinkenstecker hörte?
Ist meine pseudo-pop-literarische Schaumschlägerei nötig – noch dazu auf den Schultern eines anderen, eines wahren Künstlers – eine oberflächliche, nicht-poetische Wirklichkeit zu konstruieren? Sind meine Versatzstücke einer billig gebauten Bühne aus Sperrholz und Pappmaché entliehen? Brauche ich Kulissen für eine Alchimie des eigenen Ichs – oder: für mein phänomenales Selbstmodell? Attrappen des Schicksals nennt Weigoni diese Verweigerung jedwede(r) hermeneutische(n) Fantasie in seinen Verweisungszeichen.
Später werde ich noch einmal die Brüchigkeit von Realität (Wahrheit/Wirklichkeit/Authentizität) befragen … und man wird sehen, wie Andrascz Weigoni meine literarische Verknüpfung zu einer Identitätsfindung zerschneidet … doch über meine selbstreferenziellen Loopings ist es spät geworden … langsam und stetig dreht sich dieser Erdteil aus der Sonnenseite heraus (Señora Nada – ich greife vor) … es ist an der Zeit, die dritte CD in meinen Revox Joy oder in den alten Creek CD 60 (Philipps Laufwerk) oder in den Medion MD 4856 einzulegen. Sollte ich mir ein Gläschen von meinem feinen Cognac Tesseron Royal Blend gönnen? Feuer im Kamin entzünden? Entflammen. Morbidezza. Und während eines stimmungsvollen Sonnenuntergangs brandstiftet es dichterloh:
Im Kompositum Dichterloh wird Sprache umkodiert, oszilliert zwischen poetischer und piktographischer Erscheinung; Bedeutungsebenen werden begangen und miteinander verknüpft. Hier wird mit dem Feuer gespielt, wenngleich ohne Zerstörungswut. Weigonis Sentenzen, Worte und Verse, umherirrende Silben, Selbstlaute und Konsonanten und sogar Satzzeichen sind die Feuersteine, die ihre Funken in das komplexe Augenblicksbild einer von billigen Effekten, Exzess und Endzeitstimmung zerrissenen Zeit spucken.
Ein Langgedicht aus 86 Teilen in vier Akten (Caput I bis IV), Psychometrien der Unruhe: es wird gezündelt (Beobachtung?), entflammt (Liebe?), verlodert (Moderne?) und schließlich wird es morsch: Morbidezza! … (Tod und Vergänglichkeit?).
Dichterloh spiele ich ebenfalls ein zweites Mal ab, zu abstrakt ist das Sprachgerüst, zu verzerrt zuweilen die metaphorische Ebene, die aber beim zweiten Hören einen eigenen Denkraum aufschließt: den LebensSinn im: / Leben selbst ent / decken – und es entfaltet sich ein assoziatives Sprech-Kunstwerk der Unerklärlichkeiten. Jedes Sprachspiel eine Möglichkeit, jedes Sprechspiel deren Begrenzung. Poesie laviert hier zwischen dem Sagbaren und dem Unaussprechlichen.
Dieser Sprechsteller Weigoni, den ich eingangs (wie andere Schreiber bereits vor mir) Kompositor genannt habe, lässt mich jetzt noch einmal auf die Idee der Dekonstruktion zurückkommen.
Ein Kompositor, abgeleitet vom Begriff Komposit, ist ein Stoff (oder ein Künstler [!]), der bestimmte Materialien oder Substanzen wieder (abermals) zusammenfügt. Im engen Sinn kommt so keine Re-Konstruktion zustande, sondern eine Konstruktion; aus Auflösung formt sich etwas Neues – eine Technik, die ich hinter Weigonis Bauplänen zu seiner poetischen Wahrheit meinte gesehen zu haben.
Wagen wir noch einmal einen Ausreißer – glauben Sie mir: es lohnt sich – und wenden wir uns kurz wenigen Teilaspekten der Dekonstruktion Derridas zu, um meine Assoziationen während des Hörens der Wortkunst Weigonis zu ergründen, Assoziationen, die wie okkulte Verknüpfungen selbsttätig zu arbeiten begannen und deren Summe sich schließlich als Titel des vorliegenden Beitrages sowie als verstecktes, gleichsam durchgängiges Leitmotiv materialisierte.
Die sogenannte Dekonstruktion – selbstredend entheben wir sie hier dem Bereich der Werkinterpretation in die Philosophie hinein – stellt eines der charakteristischen Merkmale des Derridaschen Denkens dar; doch was soll die paradoxe De-Konstruktion bedeuten? Die Dekonstruktion ist weder Destruktion noch Konstruktion noch ist sie beides zugleich. De- und Kon- … »ist irgendetwas an der Grenze und im Zwischen.« (Ich zitiere mich selbst).
Derridas Dekonstruktion findet vor allem als Metaphysikkritik statt. Er geht davon aus, dass unsere abendländischen Denkbegriffe und Denkkonzepte durch die Metaphysik geprägt sind (wobei er allerdings niemals Metaphysik definiert).
Die Metaphysik moderner Vorstellung wurzelt in einer binären Gegenüberstellung opponierender Begriffspaare, wobei das eine als wesentlich, das andere als kontingent gedacht wird: Seele/Körper, Natur/Kultur, Präsenz/Absenz, Innen/Außen, Gut/Böse – und, für uns im Moment die einzige interessante Konstellation, phonetische Sprache/geschriebene Schrift.
In seiner Grammatologie lesen wir, dass für Derrida die abendländische Metaphysik ein Phonozentrismus ist. Die abendländische Tradition des metaphysischen Denkens von Platon bis zu Hegel ist stets mit dem Begriff der Stimme und deren Privilegierung verbunden, die Schrift als äußerlich, abgeleitet und sekundär vernachlässigend.
Die traditionelle Zeichentheorie nun, das sollte einem im Zusammenhang klar sein, kann als Repräsentationstheorie bezeichnet werden, die die Zeichen als Repräsentation der ursprünglichen Bedeutungen begreift. Darauf basierend formulierte Derrida seinen Textbegriff.
Der Dekonstruktivismus ist ein Kind des Poststrukturalismus. Der Poststrukturalismus macht Schluß mit dem cartesianischen Denken, stellt Selbstgewissheit und Deutlichkeit von Wahrheit in Frage und spricht vom Tod des Subjekts oder vom Tod des Menschen. Jeder Mensch sei ein sprachliches Konstrukt (Barthes, Derrida) oder ein Konstrukt diskursiver und nicht diskursiver Machtpraktiken.
Entfernen wir uns nicht zu weit von A. J. Weigoni, lehnen wir uns in eine extrem scharfe Haarnadelkurve, die uns auf halsbrecherische Weise mit der Nase auf den Auslöser meiner Weigoni-Dekonstruktivismus-Theorie stößt: Niemand kann so anschaulich und kurz das Kalkül der Dekonstruktion erklären wie der Berliner Herausgeber, Lektor und Übersetzer Marc-Christian Jäger: »Die Taktik der Dekonstruktion besteht darin, aufzuzeigen, wie Texte dahin kommen, die sie beherrschenden logischen Systeme in Verlegenheit zu bringen. Die Dekonstruktion zeigt dies, indem sie an den Aporien oder Sackgassen der Bedeutung festhält, an denen die Texte in Unannehmlichkeiten kommen, auseinanderfallen, zu sich selbst in Widerspruch geraten.«
Nehmen wir den ersten Satz und setzen Welt anstelle von Text(e) … Die Taktik der Dekonstruktion besteht darin, aufzuzeigen, wie Welt dahin kommt, die sie beherrschenden logischen Systeme in Verlegenheit zu bringen. Weigonis Taktik?
Jo Weiß schlägt in seinem Schuber-Essay auf kultura-extra.de vor, man könne Weigonis Audiobuch als »fernes Echo auf Niklas Luhmanns Liebe als Passion hören, als ein Kompositum, das zwischen phonetischen, pictografischen und onomapoetischen Formen oszilliert«, und der Dichter habe stets in Wörtern andere Wörter gesehen.
Wer Liebe als Passion liest, kann das gesamte Luhmannsche Denken erschließen: Abstraktionsvermögen der Theorie, Vergleichstechnik, das gelehrte Interesse an der Ideengeschichte. Luhmanns Gesamtwerk ist eine umfassende Theorie der Gesellschaft, die Mikro- und Makrosysteme einschließt. A. J. Weigoni gelingt ein solches Kompositum, indem er mit künstlerischem Ansatz die Theorie unserer Gesellschaft hinterfragt.
Es ist Nacht geworden, mein Kamin, den ich nicht habe, fehlt mir ein bisschen, Cognac trinke ich sowieso nicht und auf dem Boden sitzt es sich gut, auf der im Internet gekauften billigen Wolldecke, und ¼ Fund gleitet in den Schlund meines uralten Abspielgerätes, die Marke spielt doch keine Rolle – wie überhaupt sehr wenige Dinge eine Rolle spielen in unserer freien, leeren, identitätslosen Überdrussgesellschaft.
Denn: In principio erat verbum – und mir kommt es fürwahr so vor, als sage er Werbung! In principio erat … Werbung(?!?) – (et Werbung erat apud Deum, et Deus erat Werbung …).
Nein, am Anfang war also – nach dem ersten Gedanken – das erste Wort (»und nicht das Geschwätz […]« (Gottfried Benn)) – und am Ende wird nicht Werbung sein (Dinge ebenso wenig), sondern wieder der Gedanke. Und nein, vor dem Anfang war: der Gedanke.
Den 57 Stücken Letternmusik, die einen lustvoll gestalteten Redefluss als tonale Komposition mit geradezu enzyklopädischem Wissen über uns ergießen, folgt Señora Nada: Hier wieder ein genial-minimalistisches Klangbild von Tom Täger, das in diesem lyrischen Monodram die Sprache ideal bei ihren Verschiebungen und Enthebungen unterstützt. (Kalle Becker an der Sitar).
Regisseurin Ioona Rauschan (die tragischerweise im Februar 2010 an Lungenkrebs verstarb) und Sprecherin Marina Rother gelingt die Umsetzung eines immer wachsamen Erzählflusses bis zum irgendwie hohlen Quintklang am Schluß.
Hier wird nicht nur die Nachfrage nach dem Schönen, dem Diaphanen bedient – hier kann die Empfindung des Hörers über die antike, genauer über die Aristotelische Ästhetik hinausgehen bis in die Anwesenheit poststrukturalistischen Denkens.
Da ist er wieder, der Poststrukturalismus. So wie ich es intensiv beim Lesen und Hören von Dichterloh empfand, werden die Identitäten der Zeichen aufgesplittert, da sie immer wieder in einem neuen Kontext reproduziert werden, der seine Bedeutung verändert. Der Strukturalismus behauptet, dass die Signifikate und die Signifikanten eine klar abgegrenzte Struktur haben und einander symmetrisch (binär) zugeordnet sind. Bei den Poststrukturalisten ist die Sprache ein grenzenloses, sich ausdehnendes Netz, in dem ein ständiger Austausch und ein Zirkulieren zwischen den Elementen herrscht. Kein einzelnes Element ist jedoch vollständig definierbar (es existiert also kein Ursprung). Es gibt keine Wirklichkeit außerhalb der Sprache und nichts ist so brüchig, so unwirklich wie Wahrheit. Jede poetische Wahrheit ist Fiktion und Wirklichkeit zugleich.
Große Dichtung ist ein Abbild der Welt, mehr noch, sie ist immer deren Instanz. Elsa Morante, la signora Moravia, die grande dame der italienischen Belletristik, lässt uns in einem ihrer seltenen Essays (Über den Roman) an ihrer persönlichen Definition von Dichtung teilhaben, die für sie den wahren Roman, auch große Belletristik, und das Drama beinhaltet, also Lyrik und Prosa: Der Dichter, sagt Elsa Morante, lege in seinem Werk ein eigenes umfassendes System der Welt und der menschlichen Beziehungen dar. Anstatt sein System in Form von wissenschaftlichen Theorien zu entfalten, kleide er es in eine poetische Fiktion. Er setze narrative Symbole für seine Wirklichkeit.
Nach Elsa Morante ist »wahre Dichtung« ein Abbild der Welt. Poetische Wahrheiten sind genauso legitim wie wissenschaftliche Wahrheiten. So heißt es weiter: »Die Welt der Lebenden gliche nur noch einem Verfluchungs- und Vernichtungslager, wenn die Menschen aufhörten, in den wirklichen Dingen Symbole poetischer Wahrheit zu erkennen.«
Und: Das Problem der Sprache bestehe und löse sich in der psychologischen Wirklichkeit des Dichters, und zwar in der Innigkeit seiner Beziehung zur Welt.
Das Geheimnis einer neuen, universellen (poetischen) Sprache besteht in einer uneigennützigen Sympathie des Dichters mit der Welt.
Es kann nicht genügen, Krankheit und Verwüstung aufzuzeigen. Ein großer Dichter wird sich bemühen, im Chaos poetische Wahrheit wiederzufinden. Jede poetische Wahrheit erneuert die wirkliche (nicht-poetische) Welt.
Für Aristoteles war Dichtung von allen Künsten am wissenschaftlichsten, sie stehe dem Wort und Gedanken am nächsten, verkörpert die Idee und dürfe daher die höchstrangige Kunst genannt werden. In einem berühmten Diktum wertet Aristoteles sie gar höher als die Historie.
Und ich frage mich bei alldem: was – beim heiligen Prosper Tiro! – was hat mich veranlasst, meine Ballade auf den Schuber mit einer post-pop-literarischen Statik zu versehen?
Es war der Wunsch, während der Entdeckung A. J. Weigonis eine Verknüpfung zur wahren Welt, zur nicht-poetischen Wahrheit herzustellen.
In seiner Nobelpreisrede aus dem Jahr 2005 sagte Harold Pinter, die Wahrheit (im Drama) entziehe sich dem direkten Zugriff (»Truth in drama is forever elusive (…)«), jedoch gibt uns das Drama (und jede andere Dichtung) den Werkstoff zur Wahrheitskonstruktion.
Ich wollte versuchen, Dinge unserer Komfort- und Konsumrealität als Beweis einer Wahrnehmung der Komplexität unserer Welt und als Verstrebungen eines wackeligen Gebäudes aus Wunsch und Wirklichkeit zu verbauen.
Über lange Jahre hinweg favorisierte ich auch die Theorie eines angemessenen Rezeptionsraumes für die Wahrnehmung schöner (diaphaner) Werke – wie sie zum Beispiel von Ambrose Bierce in seiner Erzählung The Suitable Surroundings vorgeschlagen wird (wobei ich heute nicht mehr den Fehler mache, Fiktion als verschleierte Realität zu betrachten: nur Colston möchte uns etwas sagen, nicht Bierce; oder vielleicht doch Bierce …). Für mich ein frühes, prägendes Leseerlebnis, mit den damals neu erworbenen Kenntnissen der ersten Fremdsprache zunächst im Amerikanischen Original mehr schlecht als recht verstanden, später wieder-gelesen in der Neuübersetzung von Gisbert Haefs aus dem Jahr 1988 im Haffmans Verlag (Zürcher Edition). Ich wollte Weigoni erleben wie ein Willard Marsh, der sich das geheimnisvolle Manuskript des James Colston in der »angemessenen Umgebung« vornimmt – selbstverständlich ohne das schreckliche Ende (das Willard Marsh nahm): Ein Schriftsteller, Bierce nennt ihn James R. Colston, übergibt einem Herrn Willard Marsh ein Manuskript – ein Manuskript, »das den Leser umbringen« würde. Colston fordert für die Lektüre – für jedwede Lektüre – eine ihr jeweils »angemessene Umgebung«. Ob denn der Leser, so fragt Colston, keine Pflichten habe, die seinen (des Lesers) Privilegien entsprächen. Ein Autor habe Rechte, die er vom Leser einfordern könne; zum Beispiel das Recht auf ungeteilte Aufmerksamkeit.
Eine »Gespenstergeschichte« etwa, wie Colston sie gerade in einer Zeitung veröffentlicht hat, schreibe Bedingungen an den Leser vor: idealerweise lese man sie allein, des Nachts, beim Schein einer Kerze – bestenfalls in einem »Spukhaus« -; ein Handel wird geschlossen, Mr Marsh wird seinen Mut beweisen wollen … und so wird man jenen Herren am Nachmittag des folgenden Tages tot im »alten Breede-Haus« auffinden – einem verlassenen, heruntergekommenen und geheimnisumwitterten Gebäude – die Kerze ist erloschen, ein Tisch umgestürzt, die Blätter des »Manuskripts« auf dem Boden verstreut. Bierce-Leser kennen die Details, die sie sich idealerweise in einer frostigen Winternacht, beim Schein einer Kerze (Pflicht!) angelesen haben; vielleicht stürmte es sogar und der Ruf eines Waldkauzes zerschnitt das unheilvolle Dunkel – fast schon der totale over-kitsch … wie auch immer.
Soweit die letzte autoreferenzielle Dreistigkeit.
Meine linkische, dem Leser beinahe unzumutbare Suche nach äußerer Form sowie der Wunsch nach einem idealen Rezeptionsraum des Weigonischen Universums waren unsinnig. In meinem Irrglauben, das Netz von Querverweisen des Dichters mit nicht-poetischer Realität verknüpfen zu müssen und mit Welthaltigkeit zu verweben, spielen hier der gute Goethe, Frau von Meysenbug, Michel de Montaigne, Ambrose Bierce und Peter Bürger also eine ähnliche Rolle wie Thoreau (sowohl als Person als auch als Sessel), der Fantastic Flowers Becher, der White Hair Monkey Tee, der Revox Joy mitsamt seinen Re:sound S prestige Boxen, ein Tullsta Sessel, ein Heißgetränk Fruchtige Waldbeere und das nicht genossene Glas Tesseron Royal Blend: vernutzte Bilder und überdrehter Realismus, meine Deskription allerlei Banalitäten, Objekte der Markenrealität, werden zu meinem ästhetischen Interesse, ich selbst werde zur Ware unter Waren. Staffage. Kulissengeschiebe. Ein Fehler der popverliebten Selbstabschaffungskünstler – und doch die Chance zur Identitätsfindung.
Max Imdahl sah durch einen solchen (die Realität imitierenden) »genuinen Gestaltungsprozess« den Auslöser eines »identitäre[n] Schock[s] der Pop-Art«.
Zwei Geschehnisse entwickelten sich also für mich persönlich unter der Schale einer Rahmenhandlung, der Entdeckung Weigonis Weltidentität: die Universalität einer poetischen Wahrheit und die Universalität ihrer Rezeption in der wahren (nicht-poetischen) Welt benötigen keine Benutzer-Oberfläche aus Lebensgefühl und Markenkult. Poetische Wahrheit ist nicht fragmentarisch und jedem falschen Anschein enthoben. Sie braucht keinen Rezeptionsraum, keine Marken und eben sowenig braucht sie Bequemlichkeit. Um Weigoni zu verstehen, könnte ich mich hinfläzen, irgendwo im Wald, nur die Batterien meines Discman müssten durchhalten.
Und Weigonis dichtes (ge-dichtetes) Netz von Querverweisen würde mir bestätigen, dass alles mit allem zusammenhängt. Zeit- und raumlos, wahr und trotzdem diaphan, eben so, wie Dichtung sein muss.
Vornehmlich in der Mainstream-Literatur (sogar besonders eklatant in der Dichtung) unserer Zeit spukt das Gespenst des Fragmentarismus, einer (noch immer nachwirkenden) Fin–de-siècle–Verwirrung auf den Trümmern einer Pop-Ära – eigentlich schon auf den Ruinen des Beat – und deren wie in einer Endlosschleife regelmäßig rohrkrepierenden Reload-Versuchen (Pop-, Post-Pop … etc.). Bedauerlich.
Der Germanist Moritz Baßler meint zwar, die Frage, wie man in einer Kultur käuflicher Massenerzeugnisse das Eigene finden, definieren und halten kann, werde nirgendwo so gründlich reflektiert wie in der Pop-Literatur; aber eigentlich ist diese Reflexion überflüssig. Artisten wie A. J. Weigoni zeigen uns, wie man im Besonderen Texte machen kann, ohne medienkompatible Textmaschine zu werden und wie man im Allgemeinen auch in gesichtsloser Massen-Un-Kultur Kunst machen kann, deren Kunst und die Leidenschaft dafür ihr noch nicht abhanden gekommen sind.
Protzklöte und Gierschlunk sowie Das Reden (Nachdichtung einer nigerianischen Volkssage) schließen die vierte CD ab.
Als es am Schauplatz / waldesruhig & grabesstill / geworden ist sagt der / erste Schædel: / ›Das Reden brachte mich hierher …‹
Jetzt zermahlt einer die Worte zwischen den Zähnen.
Sogar zum Ende einer Ära, zum Setzen eines Schlusspunktes war Weigoni eingeladen: In der Mathematik ist die Sphäre die Verallgemeinerung der Oberfläche einer Kugel auf beliebig hohe Dimensionen. Wenn der Schuber die Sphäre der letzten Ausstellung im Rheintor am Burgplatz in Linz am Rhein war (fand im April dieses Jahres statt), ist diese Präsentation von Arbeiten aus dem Umfeld der beiden von Massenidentität befreiten Artisten, des Schriftstellers A.J. Weigoni und des Künstler Haimo Hieronymus, der gelungene Schlusspunkt ohne Schluß gewesen. Das Rheintor macht dicht. Diaphane Wahrheit wird weiterhin bestehen.
»Auf dem Hochseil des Kunstzirkus ist nicht viel Platz. Event-Ausstellungen und trendige Messen mit immer jüngeren Künstlerstars geben weltweit den Ton an. Da müssen sich selbst staatlich geförderte Museen etwas einfallen lassen, um ihre nicht immer taufrischen Sammlungen aufmerksamkeitswirksam zu präsentieren.« (Matthias Hagedorn)
Die im Rheintor ausgestellten Künstler – unter vielen anderen A.J. Weigoni – sind Menschen ohne Massenidentität, sie leben das Unmögliche. Der Raubbau an ihren Lebensräumen, der unaufhaltsame Entzug ihrer Sphären scheint eine logische Konsequenz unserer Epoche listiger Kulturpornografie zu sein, doch beliebig hohe Dimensionalität bricht nicht so leicht zusammen.
Ob A. J. Weigoni nun allen Ernstes ein Poststrukturalist ist, sei dahingestellt. Wahrscheinlich könnte ich dies erst mit Gewissheit annehmen oder verwerfen, nachdem er mich zu einem seiner brillanten Kollegengespräche eingeladen hätte.
Am Ende ist der Gedanke. Und am Ende ist wieder das Wort; ein letztes Wort gebührt dem Artisten Andrascz Weigoni – das Wort ist: Stumpfstotterblume. Ein Weigoni-Wort. Witzig wie Protzklöte. Man könnte auch sagen: Brunzkugeln, Gladen, Samendatteln oder Schellen. Besonders im Rheinländischen sagt man meines Wissens nach Klöten. In der Weltliteratur bekannt seit Herrn Klöterjahn, eine der Figuren in Thomas Manns Tristan. Testikel also. Und dann noch Protz-. Gierschlunk (-Schlund?) ist auch nicht harmloser, in Assoziation mit den Klöten und anhängenden Organen.
Der Autor dieser Zeilen (ha! – da ist es wieder) fühlt sich gerade wie eine Stumpf-Stotter-Blume, zu Boden geneigtes Blühtenhaupt, stumpf stotternd; derart erschlagen fühlt er sich nach dem Weigoni-Marathon, gefühlte 42,195 Klang-Kilometer, Soundrausch, Sprechakrobatik, Wahrheitsfindung und Weltenkonstruktion.
Un-fass-bar. Für den Moment bleibt mir ein stumpfes Stottern. Hat sich während ungefähr sechs Stunden – soviel Zeit muss vergangen sein, Schmauchspuren und Dichterloh habe ich zweimal abgespielt und eine Menge Denkpausen lagen zwischen den CD-Wechseln – ein Teil meiner Welt aufgelöst ohne dass sie sich in gebotener Eile neu konstruiert hätte? Irrungen und endlose Verwirrungen.
Einen Sprachzeugkasten, den hätte ich jetzt gerne.
Vielleicht war es doch ein bisschen viel, den gesamten lyrischen Weigoni an einem Stück zu hören. Ein übervoller Mond im Schlepptau gemahlener Salzkristalle … ich lebe nicht allzu fern vom Atlantik, aber zu weit für die Salzkristalle. Und als alles wieder im Schuber verstaut ist, lehne ich mich zurück und lese im Schein einer letzten Tischleuchte und des drallen Mondes etwas anderes, spontan, zur Kopfspülung: Michael Heitz, Gründer und Verleger von diaphanes, schreibt in seinem Editorial zur ersten Ausgabe des DIAPHANES MAGAZINE: »Jede Weltsicht ist an ästhetische Entscheidungen geknüpft, jeder Gedanke an seine Form, alles Urteilsvermögen an Wahrnehmung und Affekt.«
Dass es dabei immer einen Mittleren, Vermittelnden bedarf, sei angesichts der Allgegenwart des Multi- und Massenmedialen eine ebenso triviale wie tiefreichende Erkenntnis, deren feinste Triebe vom Diaphanen bei Aristoteles über Joyce bis in eine Gegenwart reichen, in der eines eklatant sei: Wie und was durch ein anderes zur Erscheinung kommt, dürfe weder den Techno- noch anderen Ideologien überlassen werden.
Ist das nicht schlicht und einfach ein Plädoyer für Freiheit?
Weigoni ist so ein Vermittler, bringt Welten durch Anderes zur Erscheinung. Ästhetisch und dabei ideologiefrei.
Für ihn sei Dichtung ein Ausdruck persönlicher und geistiger Freiheit als beständige Rebellion. (Interview mit Jens Pacholsky für das Goon-Magazin.)
Ich arbeite an der Systematik der Werkgruppen, einem dichten Netz von Querverweisen um Leerstellen zu füllen und zu sehen, wie die Welt jetzt ist, schrieb er in den Verweisungszeichen zur Literatur.
Arbeitet A. J. Weigoni, indem er sich in seine Bibliothek der ungeschriebenen Bücher vertieft, Leerstellen füllt und sieht, wie die Welt jetzt ist – … arbeitet er da nicht für die Freiheit des Geistes? Und ist das nicht der schönste Job der Welt? Ihm zuhören oder ihn lesen … das ist wie Erleben aus erster Hand.
Ich: eine Stumpfstotterblume. Andrascz Jaromir Weigoni: ein destruktiver Sinnlichkeitskonstruktor. Ich bleibe dabei.
Weigoni hören – […] and the machine stops.
- Autor: Andrascz J. Weigoni
- Titel: Der Schuber – Werkausgabe der sämtlichen Gedichte
- Ausstattung: Fünf Bücher + vier Audio-CDs + eine Original-Graphik von Haimo Hieronymus
- Verlag: Edition Das Labor, Mülheim
- Erschienen: 01/2017
- Einband: Hardcover mit Holzschnitten von Haimo Hieronymus
- Sonstige Informationen:
Foto: © Jesko Hagen
Limitierte und handsignierte Ausgabe von 100 Exemplaren
Handwerklich gearbeiteter Schuber aus genieteter Kofferhartpappe
CDs gesprochen von A.J. Weigoni, Bibiana Heimes und Marina Rother
Produktion: Tom Täger – Tonstudio an der Ruhr
Produktseite
Erwerbsmöglichkeiten
- Kursiv gesetzt sind sowohl Titel und Zitate von syntaktischen Einheiten und von isolierten Begriffen aus dem Werk A. J. Weigonis als auch Werktitel Dritter und einige fremdsprachliche Wörter, sowie wenige Verben und Substantive als Stilmittel der Betonung.
Auf korinthenkackende Identifizierung der Zitate, die nicht aus dem Werk von A. J. Weigoni stammen, wurde allgemein verzichtet. Die Urheber sind jeweils in runden Klammern angegeben.
Zitate Dritter sind immer mit Guillemets gekennzeichnet; lediglich die beiden Epigraphen bilden eine Ausnahme.
Der abschließende Satz enthält das Zitat […] and the machine stops aus der short story The Machine Stops von Edward Morgan Forster – eine Anspielung meinerseits auf den Zusammenhang von Poesie und dem Erleben aus erster Hand und dem Erleben aus zweiter Hand, dessen Aspekte hier einzubeziehen einen Roman ergeben hätte, was den Rahmen eines Essays – und erst recht einer Werkbesprechung -, sowohl stilistisch als auch den Umfang betreffend, letztendlich gesprengt hätte. [↩]








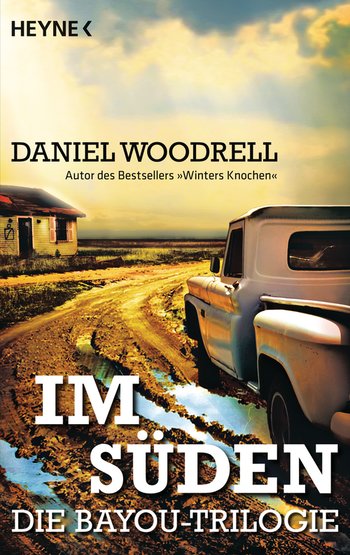

Weiterführende Informationen finden sich hier: http://www.editiondaslabor.de/?p=395