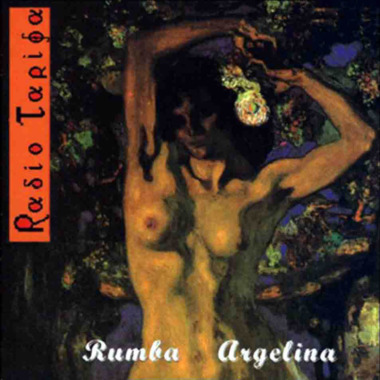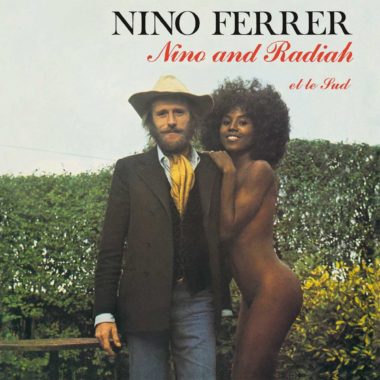Gibt es ein Musikalbum, das Ihr Leben verändert hatte?
Gibt es ein Musikalbum, das Ihr Leben verändert hatte?
Eine hehre Erwartung, ist doch Musik häufig nur dafür da, um peinliche Stille zu überbrücken, nicht um das Leben zu verändern. Und sogar dann, wenn jemand behaupten würde, eine bestimmte LP hätte sein »Leben verändert«, spräche er dabei vermutlich in Hyperbeln, denn es wird nicht »das Album« allein gewesen sein, das die Weichen einer Biographie umgestellt hatte. Viel wahrscheinlicher ist es doch, dass die besagte Musik lediglich ein deutlich hörbares Symptom eines Lebenslaufs ist, der unaufhaltsam eine Wendung nimmt. Eine Begleiterscheinung, die später als Ursache gedeutet wird, es jedoch nie wirklich war.
Und dennoch. Es gibt Alben, die aus sich selbst durchaus die Leben vieler Menschen verändert haben, da sie durch ihre musikalische Ausdruckskraft dem Zuhörer neue Dimensionen öffneten. Sie haben ermöglicht, die Welt plötzlich anders wahrzunehmen. Dies mag heute exotisch klingen, doch eine Menge Leute haben in 1967 »Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band« von den Beatles auf den Plattenteller gelegt und konnten gar nicht fassen, was sie da hören. Es gibt hunderte LPs, die bei ihrem Erscheinen eine ähnliche Wirkung auf bestimmte Menschengruppen hatten – »Kind of Blue« von Miles Davis, »What´s Going On« von Marvin Gaye, »Dark Side Of The Moon« von Pink Floyd, »Hounds Of Love« von Kate Bush, »Dummy« von Portishead, oder »Disraeli Gears« von Cream.
Es wäre somit falsch, der Musik ihre einschneidenden Kräfte abzusprechen, nur weil dies ein Phänomen ist, das immer seltener erfahren wird. Und nein – dies ist nicht eine weitere Tirade mit dem vorhersehbaren »früher war alles besser«. Denn es gibt auch heute eine Menge großartiger Musik, auch Musik mit wahrhaftig transformativem Potential. Doch ihr gegenüber steht eine noch nie dagewesene Hektik, welche den gesamten Planeten umspannt. Jeder hastet nur noch von einer Lebensstation zur nächsten. Musik wird hierbei in ähnliche Manier konsumiert – hektisch und beiläufig.
So sind aus feierlichen musischen Banketten der Vergangenheit uninspirierte Ausflüge zum Snack-Automat im Erdgeschoss geworden. Die transformative Erfahrung wird den Menschen heute oft versagt, denn Musik ist eine Art »digitale Utilität« geworden, die man dazu verwendet, um die eher langweiligen Abschnitte des Lebens etwas signalreicher, etwas reizvoller zu gestalten – Zugreisen in die Arbeit, das Sortieren von Belegen im Büro, das Sitzen in Wartezimmern.
Und gegen all das ist erstmal nichts einzuwenden. Natürlich ist Musik dafür da, um uns durch den Alltag zu begleiten. Musik ist durchaus auch funktional. Das war sie schon immer. Aber sie kann eben mehr. Doch dazu gehören das Erleben der »Suche« und die daraus resultierende Erfahrung der »Entdeckung«. Hierbei gilt es stets, die profanen, ausgetretenen Pfade der kreischenden Werbung zu verlassen, denn dort – im grellen Licht der Werbebotschaften – ist Musik wirkungslos und unbedeutend. Die wahren Schätze liegen dort, wo auch der Schatten beginnt. Dort, wo sich die wahren Geheimnisse offenbaren. Die echten Dramen.
So mag man sich heute durchaus für eine musikalische Neuerscheinung begeistern, sogar ereifern – doch sein wir doch mal ehrlich, ein wahrhaftiger »game changer« kommt dabei selten heraus. Ich würde sogar so weit gehen und sagen: Wann hat jemals jemand ein lebensveränderndes Musikerlebnis anhand eines Albums erfahren, das man durch die Werbung aufgedrängt bekam?
Die tiefgreifenden Begegnungen mit Musik finden woanders statt. Dies mag sich beim Durchgehen der Musik-Sammlung eines Freundes ereignen, oder bei einem spontanen Ausflug in einen Plattenladen. Doch hier merkt man schnell, weshalb die musikalische Epiphanie so vielen versagt bleibt. Denn wer hat noch Freunde mit großen Musiksammlungen, von dem rustikalen Plattenladen gar nicht zu sprechen? Eine musikalische Kollektion findet sich heute zumeist auf der Festplatte eines iPods oder eines iPhones, und das ist mit Abstand der langweiligste Platz, um Musik aufzubewahren. Und wenn die ersten Solar Superflares auf die Atmosphäre der Erde treffen, wird dieses Medium noch eine Spur langweiliger. By the way – wenn ich schon so sehr vom Thema abschweife -, es ist doch hoffentlich allen klar, dass Steve Jobs daheim Schallplatten gehört hat. Er ist nicht mit einem iPod durch die Gegend gelaufen, außer die Kameras waren eingeschaltet.
So bleibt heute fast nur die Bar übrig, vorausgesetzt dort läuft ausnahmsweise etwas Gutes. Eine Nachfrage beim Barkeeper kann mit etwas Glück ein ganzes neues Universum aufreißen. Natürlich kann sein, dass man bis dahin Alkoholiker geworden ist, doch ist diese Option chancenreicher, als auf eine akustische Erleuchtung mittels einer der belanglosen Autoradio-Stationen zu warten, welche hierzulande den Äther vergiften.
Es ist eben so, dass auch die besten Alben nicht universell auf Menschen einwirken können. Was ich für das beste Album der Welt halte, mag Ihnen gänzlich missfallen. Und das ist etwas, das ich friedfertig akzeptieren muss, wie enttäuschend es sich auch anfühlen mag. In einer Welt der Vielfalt und der geistigen Freiheit muss es auch Leute geben, die meinen Geschmack zum Kotzen finden. Ich bin zumindest zivilisiert genug, um darüber nur heimlich zu fluchen.
Der Mensch ist eben ein Zuhörer und kein »Manchurian Candidate«. Sie müssen sich selbst in einer Phase des Lebens befinden, auf welche der Zauber eines bestimmten Albums einzahlt. Sie selbst müssen zu diesem Zeitpunkt ein optimales Gefäß sein, das mit dieser neuen Musik gefüllt werden kann. Man muss suchen, ohne zu wissen, was man sucht – und mit etwas Glück wird man gefunden.

Und so erging es mir. Im Winter 1989 ging ich entlang der Rosenheimer Straße in München – auf Plattenkauf. Ich wohnte damals nur zwei Straßen weiter. Haidhausen ist ein schönes Viertel. Zumindest damals war es eine eher preiswerte Gegend und die betuchten Spießer zogen lieber in das benachbarte Bogenhausen. Haidhausen war stets eine Art Schwabing, nur ohne die reichen Idioten. Hier wohnten Künstler, Abenteuer und Verrückte. Und so gab es dort auch allerlei gute Second-Hand-Plattenläden. Und der Laden, den zu betreten ich im Begriff war, den gibt es dort heute noch – was durchaus eine schöne Sache ist. »M2« ist eine regelrechte Hochburg des Vinyls und eine tolle Anlaufstelle für anspruchsvolle »Sound Chaser«.
Freilich damals, vor fast 30 Jahren, war der Anstrich des Nostalgischen nicht da. Die Vinylscheibe war noch immer das zentrale Vehikel der Musikindustrie – die CD hatte zwar längst die Überholspur eingenommen, doch uns allen fiel es ein wenig schwer, den Zauber der großen Plattenhüllen widerstandslos aufzugeben, zugunsten von schlecht reproduzierten Fotos hinter einer hässlichen Plastikscheibe. Die »Indie«-Ecke befindet sich heute ganz am Ende des schmalen Korridors, doch damals war Independent direkt am Eingang links. Und das war die Musik, die mich in diesen Jahren interessierte.
Ein Plattensammler war ich allerdings nicht. Dafür hatte ich zu wenig Geld. Ich war achtzehn Jahre alt, wohnte am Weißenburger Platz in einer WG, die aus recht abwegigen Leuten bestand und geregeltes Einkommen war nicht wirklich ein Konzept, das ich hinreichend verinnerlicht hatte. Nun, das habe ich bis heute nicht – aber das ist eine andere Geschichte.

Ich hatte zwei Jahre später sogar einen Musikversand mit dem Namen »Ritual Music« gegründet, weil ich mir Platten und CDs zum Einkaufspreis leisten wollte. Ein Konzept, das finanziell nicht ganz durchdacht war, aber immerhin dazu führte, dass daraus später das durchaus gepriesene Label »Ant-Zen« wurde.
Dass ich mich nun, an diesem besagten Tag in 1989, trotz großer Löcher in den Hosentaschen, doch einem Plattenladen näherte, hatte mit Yvonne zu tun. Ah, jetzt habe ich Ihre Aufmerksamkeit, nicht wahr? Ich bin sicher, Sie waren kurz davor wegzunicken, angesichts all der informativen Trivia. Doch man muss nur den Namen einer Frau einstreuen und schon ändert sich die Wahrnehmung.
Yvonne war ein Gothic. Die Leute nannten es auch »Gruftie«, was nicht immer so gerne gehört wurde, da der deutsche Sprachraum dieses Wort bereits Jahre zuvor für Rentner und alte Leute im Allgemeinen reserviert hatte. Und im Nachhinein ist es etwas schwer festzustellen, ob diese verbale Überschneidung damit zu tun hatte, dass beide Gruppen (also Gothics und Rentner) eine Affinität für Grabsteine und Grablichter hatten, – oder ob Außenstehende lediglich der Meinung waren, dass beide Gruppen verdächtig ähnlich rochen.
Ohnehin wurde man damals nicht einfach »Gothic«. Dafür war die Szene sogar für die 80er im Erscheinungsbild zu extrem, von den teilweise exzentrischen Ansichten gar nicht zu sprechen. Ein »Gothic« wurde man de facto nur, wenn man bereits eine der akzeptierten »Einstiegsszenen« absolviert hatte, die hier in Frage kamen: New Wave, Punk, Independent oder New Romantic. Ich weiß, das klingt sehr reglementiert, aber im Bezug auf Subkultur waren die 80er durchaus das Zeitalter der Fahnen und Kategorien. Zuwachs war immer willkommen, aber nur wenn man nach der akzeptierten Pfeife tanzte. Dies waren eitle Zeiten. Es war nicht schwer, jährlich zehn bis zwanzig Dosen mit Haarspray zu verschwenden. Ich finde es erstaunlich, dass ich heute noch einen so gesunden Haarwuchs habe. Müssen wohl die Gene sein.
Das alles hat heute – im Post-Loveparade-Zeitalter – keine richtige Bedeutung mehr. Und vielleicht ist das auch besser so. Das zwanghafte Beanspruchen einer Fahne, unter die man sich stellen kann, um dann alle anderen ständig schlecht zu machen, hat heute nur noch im Fußball überlebt. Doch war es damals weniger lächerlich, wenn man sich ereiferte, ein Metaller zu sein, ein Punk, ein Teddy, ein Psychobilly oder ein Skinhead? Wer denkt heute noch in so strengen Abgrenzungen? Helene-Fischer-Fans vielleicht. Es ist, als hätte man in den späten 90ern die bunte Wäsche so lange in derselben Waschmaschine gewaschen, bis alles dieselbe Farbe hatte.
Umgekehrt könnte man allerdings argumentieren, dass es in einem gewissen Alter durchaus gesund sein kann, sich in eine Szene oder Gruppierung einzuordnen. Doch meine Intuition flüstert mir ein, dass es hierbei vermutlich auf den zweiten Schritt ankommt – die Fähigkeit, die Szene wieder hinter sich zu lassen. Denn schließlich sind wir alle auf der Suche nach einer eigenen Identität. Es ist immer etwas befremdlich, wenn nicht sogar traurig, wenn jemand nach dreißig Jahren immer noch »Punk« oder »Gothic« ist. Doch ich schweife wie gewohnt ab.
Yvonne war geradezu ein Poster-Gothic. Hätte man ein Coffee-Table-Buch über Gothics herausgegeben (und vermutlich gibt es so etwas auch), man hätte ihr Foto auf die Titelseite stellen können. Ihre pechschwarzen Haare waren in alle Richtungen toupiert und bedeckten über die Hälfte des blassen Gesichts. Es glich mehr einem Glücksfall, wenn man in all den Schatten ihre Augen entdecken konnte. Sie rauchte eine Zigarette nach der anderen und war im Stande, ganze Stunden wortlos in Bars und Clubs zu sitzen und einfach nur traurig zu blicken. Melancholie kann ein Genuss sein, vorausgesetzt man ist jung. Es ist ein magischer Ritus, sich von der grellen, lächerlichen Welt da draußen abzusetzen und sich gänzlich dem Kult des Weltschmerzes zu ergeben. Doch es war auch viel Show dabei. Ich weiß das, denn wir haben sehr viel gelacht.
Doch nicht immer. Yvonne wohnte in einem Mädchenheim für Waisenkinder und jene, die das Pech hatten, Vergewaltiger und Schlägertypen zum Vater zu haben. Sie hatte auch einen unsympathischen, Doc Martens tragenden Arsch zum Freund, der natürlich EBM hörte, sie mies behandelte und von dem sie sich dennoch nicht trennen konnte. Es war alles so herrlich tragisch. Es war ein Füllhorn für Klischees und freudsche Reflexionen.
Abendliche Besuche waren im Wohnheim zwar nicht erlaubt, doch wir waren Teenager und unser Sinn stand nicht nach Regeln und Vorschriften. Yvonne besaß einige Schallplatten, die sich gegenseitig in Düsternis und Depression übertrumpften. Darunter auch ein Album von Dead Can Dance. Ich kann nicht behaupten, allzu viel Erinnerung an die ersten Klänge zu haben, die ich von dieser epochalen Ausnahmeband damals gehört hatte. Dafür war ich wohl viel zu sehr von Yvonne fasziniert und von all dem Patschuli benebelt. Doch der Bandname hatte seine Neuronalverbindungen in meinem Gehirn in Beschlag genommen – dies war noch ein Alter, in dem ich mir alles merken konnte, was ich las, hörte oder sah.
So begab ich mich am nächsten Montag in den besagten Plattenladen. Ich hatte zwar nicht viel Geld dabei, doch ich wusste, dass es nun galt, Fakten zu schaffen und meine Musiksammlung aufzustocken. Denn über Musik definierte sich damals ein beachtlicher Teil jeglicher der Szenezugehörigkeit. Ich war damals ein typischer New-Wave-Typ, der sich beim Sikrodil die Haare an den Seiten ausrasieren ließ und der The Cure oder Depeche Mode hörte. Doch ich wusste nun, dass der Kaninchenbau viel tiefer als bis zum Synthi-Pop führte.
Und so landete diese Schallplatte in meiner Hand. Die Titelseite war unbeschriftet, mit nur einem rätselhaften Bild auf dem schwarzen Hintergrund, das auch noch dezentral nach links verschoben war. Was hatte das alles zu bedeuten? Ich drehte die Hülle um und starrte auf die ersehnten Schlüsselwörter – Dead • Can • Dance.

So zahlte ich zwölf Mark und trat wieder hinaus in den frostigen Dezemberabend. Der Weißenburger Platz befand sich nur einige hundert Meter entfernt, so dass ich bereits wenige Minuten später die Vinylscheibe auf Emils Plattenteller gelegt hatte und die Nadel in die Rille platzierte. Emil war der einzige in der WG, der von morgens bis abends gearbeitet hatte. Dadurch kam ich zu den meisten Uhrzeiten an seine Stereoanlage heran.
Und so hörte ich zum ersten Mal »Within The Realm Of A Dying Sun«. Ich war ein Gefäß, perfekt präpariert für die Annahme dieser Musik. Ich habe seit dem hunderte Alben entdeckt und gehört – darunter ohne Zweifel auch Meisterwerke und Geniestreiche – doch keine dieser Scheiben konnte jemals diesen musikalischen Monolith in meinem Gehirn verdrängen.
»Within The Realm Of A Dying Sun« ist womöglich das düsterste Album aller Zeiten. Es besitzt keine elektrischen Gitarren und kann es doch jederzeit mit allen Doom- und Death-Metal-Alben der Welt aufnehmen. In diesem Werk gibt es keinen einzigen Ton, der beschwichtigend und leichtherzig wäre. Es gibt keine einzige gutgelaunte Melodie und nicht ein Akkord kommt mit einem lautseligen Ellbogenschubser daher. Von der ersten bis zur letzten Sekunde tönt alles im Zeichen einer tiefgreifenden Traurigkeit. Es gibt keine Kompromisse auf diesem Album. Dies ist eine Zeremonie der Moll-Klänge, aus der alle fröhlichen Töne vertrieben wurden.
Doch wenn ich sage, dies sei das düsterste Album aller Zeiten, so beginnt hier bereits der Diskurs darüber, was eigentlich mit »düster« gemeint ist. Düsternis kann viele Gesichter haben. Die Wesenszüge dieses Begriffs mögen von einem gewissen Schaudern, bis hin zu unverhüllter Depression reichen. »Within The Realm Of A Dying Sun« hat allerdings so gar nichts Depressives an sich. Diese Auszeichnung sollte eher an das Album »Vena Cava« von Diamanda Galas gehen.
Die Magie von Dead Can Dance liegt in einer unvergleichlichen Hochzeit zwischen Traurigkeit und Schönheit. Doch »Within The Realm Of A Dying Sun« ist auch eine allegorische Reise entlang der Grenze zwischen Mensch und Natur.

Das Album hat eine programmatische Struktur. Dead Can Dance ist in erster Linie ein Duo, bestehend aus dem Anglo-Iren Brendan Perry und der Australierin Lisa Gerrard. Auf dem Album spiegelt die A-Seite verstärkt Brendans lyrische Seite, während die B-Seite vollständig von Lisas unerschöpflichem Alt und Mezzosopran beherrscht wird.
Nur drei Stücke auf diesem Album haben einen Text. Brendan Perrys Lyrik ist durchwachsen mit existentialistischen Fragen und der stetigen Ablehnung einer närrischen Welt der modernen Marktschreier und Trickbetrüger, welche wir längst zu den Führern dieser Zivilisation erhoben haben.
Im ersten Stück, mit dem rätselhaften Titel »Anywhere Out Of The World« wundert sich Brendan, ob das Leben überhaupt noch lebenswert sei:
Und vielleicht ist es leichter,
Sich dem Leben zu entziehen,
Mit all seinem Elend und seinen erbärmlichen Lügen,
Dem Unheil fern.

Jene schaurige Trauer, welche das Album unentwegt abstrahlt, gleicht mehr einer Aporie. Es hält in einem übermenschlichen Balanceakt jenen Augenblick fest, der uns alle früher oder später ereilen mag: die aporische Erkenntnis, dass es keine Medizin gegen Vergänglichkeit und Verfall gibt und dass alles, was dem Menschen bleibt, in der Schönheit des einen Augenblicks liegt, den man da gerade erleben mag. Hier wird durch Musik das Leben als eine unmittelbare Wirklichkeit empfunden, fern des vorlauten, aufdringlichen Alltagslärms, der uns unentwegt bei Laune hält und den wir manchmal zu sehr in den Mittelpunkt unserer Leben rücken, um keinen Nervenzusammenbruch zu erleiden. Dies ist die sterbende Welt, so wie sie wirklich ist, wenn man all das krampfhafte Kichern und Gackern abstellt. Der Ausdruck von Einsamkeit inmitten wirbelnder Schneeflocken, so perfekt in dem zweiten Stück »Windfall« festgehalten.
Und wenn es dann in »In The Wake Of Adversity« heißt:
Ahnungslosigkeit,
Der Narren Leuchtfeuer lenkt auf einen launenhaften Pfad,
Und setzt einen Kurs,
Auf welchem wir segeln in die ungewisse Nacht.
… so fühlt man sich gerade heute, in der Ära Trump, deutlich angesprochen. Haben wir nicht schon immer gespürt, dass ein zentraler Wesenszug dieser naturvernichtenden Zivilisation darin besteht, dass die Wissenden stets in zweiter Reihe sitzen, während der Vorsitz dieser Welt von den ahnungslosen Bürokraten und Advokaten bestritten wird? Hier scheint es, als ob Platons Politeia zwischen den Verszeilen heraufbeschworen wird.
Durch diese Musik erfahren wir, dass es in Ordnung ist, traurig zu sein. Denn dies ist keine niedergeschlagene Gram. Es ist eine erhabene Trauer und ein Ausdruck dessen, dass der Zuhörer emotional gereift ist, während die infantilen Narren noch immer heiter ihren Tyrannen zujubeln. Und deshalb ist »Within The Realm Of A Dying Sun« seit 1989 mein Lieblingsalbum. Ein Wurf, der vollständig nur aus Inspiration besteht. Befreit von jeglicher Banalität. Es ist das durchschlagendste und wichtigste Musikwerk der Neuzeit.
Nun, zumindest in einem Universum, in dessen Mitte ich stehe. Doch ich habe kein anderes anzubieten.
Und was ist aus Yvonne geworden? Ich weiß es nicht. Unser Umgang war von recht kurzer Dauer. Doch sie war zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, um als Einstiegshelfer in diese herzergreifende Musik zu wirken. Wie schon Umberto Eco geschrieben hatte: Was von einer Rose bleibt, ist ihr Name.
Oder so ähnlich.

Quellen:
“futuristic spaceship command room” by Luca Oleastri @ fotolia
Cover © 4AD
Bandfotos © Dead Can Dance/4AD